Durch einen Ehevertrag lassen sich diverse Scheidungsfolgen individuell regeln. Zu diesen Scheidungsfolgen zählt auch der Unterhalt – wenn auch nur in eingeschränktem Ausmaß. Es kann durchaus vorkommen, dass vertragliche Vereinbarungen einer gerichtlichen Prüfung nicht standhalten. Sind einzelne Vertragsklauseln ungültig, riskiert man damit, dass der gesamte Ehevertrag unwirksam ist. Eine allgemeine Orientierung liefert Ihnen der folgende Artikel. Sie erfahren mitunter, welche Vereinbarungen möglich sind und welche Kriterien dabei zu berücksichtigen sind.
Ein Ehepaar kann diverse Angelegenheiten durch einen Ehevertrag individuell regeln. Auf diese Weise kann auch der Unterhalt und der Versorgungsausgleich an die Wünsche der Ehepartner angepasst werden. Für einen Ehevertrag gilt gemäß § 1408 im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) Vertragsfreiheit. Dennoch muss dieser bestimmte Kriterien erfüllen. Hier spielen mehrere verschiedene Ebenen eine Rolle, die wir Ihnen im Folgenden schildern werden.
Rechtsgültig ist ein Ehevertrag laut § 1410 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) nur dann, wenn er einvernehmlich vereinbart und von einem Notar beglaubigt wird.
Die Gestaltung des Ehevertrags unterliegt gewissen Einschränkungen, die sich aus der Schutzfunktion des Gesetzes und den im Familienrecht festgeschriebenen ehelichen und familiären Pflichten ergeben. So heißt es zum Beispiel in Artikel 6, Abs. 1 des Grundgesetzes (kurz GG), dass Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stehen. Außerdem sind die Ehepartner gemäß § 1353 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) verpflichtet, füreinander Verantwortung zu tragen.
Für Rechtsgeschäfte bzw. Verträge im Allgemeinen gilt gemäß § 134 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB): „Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt.“ Bei der Gestaltung eines Ehevertrags ist also zu prüfen, inwieweit die dort getroffenen Regelungen mit dem Gesetz vereinbar sind. Zwar können Vereinbarungen zum Unterhalt im Ehevertrag die vom Familienrecht vorgegebenen Regelungen ablösen, manche Unterhaltsformen stehen jedoch unter besonderem gesetzlichen Schutz.
Generell sieht der Gesetzgeber durch § 1614 im Bürgerlichen Gesetzbuch (kurz BGB) vor, dass die Eheleute nicht für die Zukunft auf Unterhalt verzichten können. Das gilt unter anderem für den Trennungsunterhalt, der für die Zeit ab der Trennung bis zur Scheidung beansprucht werden kann. Da sich die Partner auch während der Zeit der Trennung noch in der Ehe befinden, sind sie in dieser Zeit noch in stärkerem Maße füreinander verantwortlich. Ebenso steht das Kindeswohl unter besonderem gesetzlichen Schutz, sodass auch ein Verzicht auf Kindesunterhalt unzulässig ist.
Vereinbarungen über den nachehelichen Unterhalt sind hingegen laut § 1585c Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) grundsätzlich möglich. Diese können unter gewissen Umständen auch einen Verzicht beinhalten. Jedoch gibt es auch hierbei Einschränkungen. In der Rechtsprechung orientiert man sich dabei mitunter an der sogenannten Kernbereichslehre. Danach ist eine Vereinbarung zum Unterhalt nur dann zulässig, wenn diese nicht in den Kernbereich der gesetzlichen Grundsätze eingreift. Daraus ergeben sich Rangabstufungen bezüglich der unterschiedlichen Formen des nachehelichen Unterhalts, die wir im weiteren Verlauf dieses Textes näher betrachten werden. Die Rangabstufungen geben vor, in welchem Ausmaß individuelle vertragliche Vereinbarungen vorgenommen werden können.
Eine weitere Betrachtungsebene für die Beurteilung ob ein Ehevertrag zulässig ist oder nicht, ergibt sich aus der Frage, ob eine sogenannten Sittenwidrigkeit vorliegt. Dies ist durch § 138 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) festgelegt. Demnach ist ein Vertrag, der gegen die guten Sitten verstößt, nichtig. Durch diesen Gesetzesparagraphen sollen Personen geschützt werden, die einen sie benachteiligenden Vertrag zum Beispiel aufgrund von Unwissenheit unterzeichnet haben oder sich aus anderen Gründen in einer schwächeren Verhandlungsposition befanden.
Laut § 313 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) kann auch eine Abänderung des Ehevertrags notwendig sein, wenn eine Störung der Geschäftsgrundlage vorliegt. Das ist dann der Fall, wenn sich die Umstände nach der Vertragszeichnung so verändert haben, dass die Grundlage, anhand derer die Partner damals den Vertrag in der nun vorliegenden Form veranlasst haben, nicht mehr gegeben ist.
Zur Beurteilung, ob ein Vertrag wirksam ist oder nicht, kommt es auf das Gesamtbild und eine sorgfältige Abwägung der vertraglichen Vereinbarungen, der gesetzlichen Vorgaben und der Umstände der Eheleute an. Diese Kriterien sind je nach Einzelfall anders gelagert und werden für eine gerichtliche Beurteilung eingehend betrachtet.
Möchten die Ehepartner Regelungen zum Unterhalt im Ehevertrag treffen, sind also viele Dinge zu beachten. Es ist daher ratsam, einen solchen Vertrag auf jeden Fall mit einem Anwalt für Familienrecht aufzusetzen. Dies umso mehr, da laut § 139 im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) eine einzelne Vertragsklausel, die nichtig ist, dazu führen kann, dass der gesamte Vertrag ungültig ist. Was bei der Gestaltung eines Ehevertrags zu beachten ist und welche Regelungen für die verschiedenen Unterhaltsformen in Frage kommen, erfahren Sie im Folgenden.
Es steht Ehepaaren offen, bestimmte Scheidungsfolgen in ihrem Ehevertrag zu regeln. So können auch Vereinbarungen zum Unterhalt und zum Versorgungsausgleich getroffen werden. Damit der Vertrag auch rechtsgültig ist, müssen Sie diesen von einem Notar beglaubigen lassen. Außerdem sollten Sie im Voraus mit einem Anwalt für Familienrecht abklären, ob Ihr Ehevertrag in der gewünschten Form auch zulässig ist. Lassen Sie den Vertrag am besten von diesem aufsetzen, damit er auch ordnungsgemäß und im Gesamten schlüssig ist.
So können Sie verhindern, dass der Ehevertrag vor Gericht letztendlich als unwirksam beurteilt wird. Werden einzelne Vertragsklauseln als unwirksam erklärt, kann das sogar dazu führen, dass der gesamte Ehevertrag nichtig ist. Sie können den Vertrag übrigens jederzeit schließen – auch noch während des Scheidungsverfahrens und vor der Ehe.
Für Unterhaltsvereinbarungen im Ehevertrag gibt es verschiedene Möglichkeiten. Je nach Art des Unterhalts kann man die Unterhaltsansprüche entweder abändern, erhöhen, begrenzen oder darauf verzichten. Besonders für den Ausschluss von Unterhalt sind einige Dinge zu beachten. In unserem Artikel Unterhaltsverzicht erhalten Sie ausführliche Informationen dazu. Grundsätzlich gilt:
Möchten Ehepartner Regelungen zum Unterhalt treffen, dann gilt zwar grundsätzlich Vertragsfreiheit, dieser sind jedoch Grenzen gesetzt. Die Grenzen ergeben sich aus dem Schutzzweck des Gesetzes. Durch die Beschränkung der Vertragsfreiheit wird verhindert, dass der Schutzzweck nach Belieben durch vertragliche Regelungen unterlaufen werden kann.
Die Gestaltungsfreiheit soll nicht dazu führen, dass ein Ehepartner diese zu Lasten des anderen und zum eigenen Vorteil missbraucht. Im Familienrecht selbst gibt es zwar nur wenige Stellen, die sich explizit zur Gestaltung von Unterhaltsvereinbarungen in Eheverträgen äußern. Durch die Rechtsprechung haben sich in der Praxis jedoch einige Richtlinien für den Umgang mit vertraglichen Unterhaltsregelungen herauskristallisiert. Für die Gestaltung des Ehevertrags gilt generell:
Das Gesetz unterscheidet zwischen verschiedenen Unterhaltsformen und gibt grob vor, inwieweit diese individuell geregelt werden können. Dabei hat sich der Vertrag an die guten Sitten zu halten. Das heißt: Auch wenn Vereinbarungen zu bestimmten Unterhaltsformen grundsätzlich erlaubt sind, können diese unwirksam sein, wenn sie gegen die guten Sitten verstoßen
Eine Begrenzung bzw. ein Verzicht auf Unterhalt sollte nicht zur Folge haben, dass der anspruchsberechtigte Partner dadurch auf Sozialleistungen zurückgreifen muss.
Durch das Familienrecht ist festgelegt, dass für die Zukunft nicht auf Unterhalt verzichtet werden kann. Auf diese Weise soll ein rechtmäßiger Schutz der Eheleute bzw. der Familie bei Trennung bzw. Scheidung gewährleistet sein. Schließen die Eheleute künftige Unterhaltsansprüche aus, dann kann das zu einer damals noch unvorhersehbaren Notlage führen.
Das betrifft zum Einen den Trennungsunterhalt, der einem Partner für die Zeit der Trennung bis zu Scheidung zustehen kann. Zum Anderen steht auch das Wohl der Kinder unter besonderem gesetzlichen Schutz, sodass auch der Kindesunterhalt nicht ausgeschlossen werden kann. Anders verhält es sich hingegen beim nachehelichen Unterhalt. Nach der Scheidung sind die Ehepartner vorrangig für sich selbst verantwortlich. Der Gesetzgeber sieht daher vor, dass Vereinbarungen zum nachehelichen Unterhalt auch für die Zukunft möglich sind.
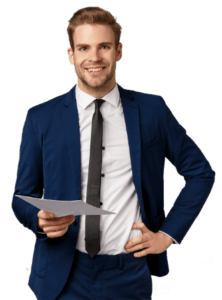
Eine Begrenzung oder ein Verzicht auf nachehelichen Unterhalt ist zwar generell möglich. Es gibt jedoch verschiedene Formen von nachehelichem Unterhalt, welche sich auch in der Rangordnung untereinander unterscheiden. Man spricht hierbei von der sogenannten Kernbereichslehre, die in der Rechtsprechung zur Anwendung kommt. Das heißt: Verzichten die Partner auf solche Unterhaltsarten, die zum Kernbereich zählen, kann dieser Verzicht vom Gericht mit höherer Wahrscheinlichkeit als unwirksam erklärt werden.
Je nachdem, um welche Form des Unterhalts es sich handelt, besteht also mehr oder weniger Gestaltungsspielraum für die Eheleute. Das Kindeswohl steht für den Gesetzgeber im Vordergrund, wodurch der Betreuungsunterhalt auch zum Kernbereich zählt und daher in der Rangabstufung der Unterhaltsformen ganz oben angesiedelt ist. Im Folgenden eine Auflistung der verschiedenen Formen des nachehelichen Unterhalts in der Reihenfolge ihrer Rangabstufung:
Diese Rangabstufung gibt lediglich Aufschluss darüber, für welche Unterhaltsformen mehr Gestaltungsspielraum gegeben ist und für welche individuelle Regelungen eher problematisch werden können. Auch wenn sich der Betreuungsunterhalt in der Rangabstufung ganz oben befindet, heißt das nicht, dass ein Verzicht auf Betreuungsunterhalt in jedem Fall unzulässig ist. Es kommt vielmehr auf eine genauere Prüfung der Gesamtumstände an. So besteht zum Beispiel auch für den Betreuungsunterhalt durchaus die Möglichkeit, dass eine Begrenzung auf eine niedrigere als die gesetzliche Unterhaltssumme wirksam geltend gemacht werden kann – vorausgesetzt, die finanziellen Verhältnisse lassen dies zu.
Ob ein Ehevertrag oder bestimmte Regelungen darin unwirksam sind, ergibt sich oft erst durch ein entsprechendes Gerichtsverfahren. Die Ehepartner können also auch dann Unterhalt beanspruchen, wenn sie diesen durch die vertraglichen Vereinbarungen ausgeschlossen haben. Das Gericht prüft dann, ob der Vertrag sittenwidrig ist oder aus anderen Gründen abzuändern ist.
In der Regel erfolgt eine gerichtliche Prüfung erst auf Veranlassung eines Beteiligten. Wie diese vonstatten geht, erfahren Sie im Abschnitt „Wirksamkeitskontrolle durch das Gericht“. Vor Gericht werden immer beide Seiten in vollem Umfang betrachtet und abgewogen um ein Gesamtbild zu erhalten – auch die finanziellen Verhältnisse der Ehegatten werden dabei einbezogen. Folgende Kriterien können dabei berücksichtigt werden:
Form des Unterhalts (Rangabstufungen)
Die Sittenwidrigkeit eines Vertrags liegt dann vor, wenn ein Ehepartner durch die Vereinbarungen einseitig benachteiligt wird und davon ausgegangen werden kann, dass er diesen nur zugestimmt hat, weil er sich in einer unterlegenen Verhandlungsposition befand. Zur Feststellung, ob ein Ehevertrag sittenwidrig ist, sind alle Vereinbarungen im Ehevertrag zu überprüfen.
Erst aus dem Gesamtbild kann geschlossen werden, inwiefern ein Ehegatte durch die Regelungen einseitig benachteiligt ist. Eine Benachteiligung durch eine einzelne Regelung ist also nicht ausreichend. Es geht vielmehr um die Auswirkung, die sich aus der Kombination aller Vereinbarungen ergibt. Gehen diese in ihrem Zusammenwirken zu Lasten eines Ehegatten und werden durch nichts anderes ausgeglichen, so besteht Grund zum Verdacht, dass der Ehevertrag sittenwidrig ist.
Doch: Um einen Vertrag endgültig als sittenwidrig zu bezeichnen, sind auch die Umstände bei der Vertragsschließung zu betrachten. Was waren die Gründe, die die Ehegatten dazu veranlasst haben? Befand sich der benachteiligte Gatte in einer unterlegenen Position, die dazu führte, dass diese starken Nachteile in Kauf genommen wurden? Von einer unterlegenen Verhandlungsposition kann zum Beispiel dann gesprochen werden, wenn:
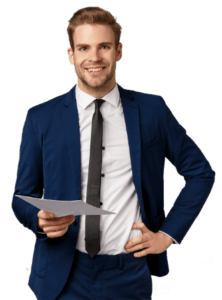
Um festzustellen, ob Vereinbarungen im Ehevertrag zulässig sind oder nicht, erfolgt vor Gericht eine sogenannte Wirksamkeitskontrolle. Im Rahmen dieser Wirksamkeitskontrolle wird der gesamte Ehevertrag in zwei Schritten überprüft. Ergibt sich aus dieser Überprüfung, dass einzelne Regelungen im Ehevertrag nichtig sind, wird weiters untersucht, ob dadurch auch die anderen vertraglichen Vereinbarungen einer erneuten Beurteilung bedürfen.
In einem Ehevertrag greifen meist mehrere Regelungen ineinander, wodurch es bei der Nichtigkeit einer Klausel dazu kommen kann, dass der Ehevertrag zur Gänze unwirksam ist. Je nach Ergebnis der Wirksamkeitskontrolle entscheidet sich, ob Unterhaltsansprüche gegeben sind oder nicht und ob eine Abänderung des Ehevertrags vorgenommen werden muss. Die Beurteilung durchläuft folgende Schritte:
Eine Abänderung der Unterhaltsansprüche, wie sie durch den Ehevertrag festgelegt wurden, ist dann möglich, wenn dies nach erfolgter Ausübungskontrolle naheliegend ist. Wie oben erwähnt wurde, kann das der Fall sein, wenn die eheliche Lebenssituation zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung eine ganz andere war und die vertraglichen Vereinbarungen somit in der aktuellen Situation der Eheleute nicht mehr zumutbar erscheinen. Eine Änderung kann aber auch dann beantragt werden, wenn sich die Rechtslage seitdem verändert hat.
In einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 18.02.2015 – Az. XII ZR 80/13 wurde die Möglichkeit zur Abänderbarkeit von Eheverträgen in Anpassung an die Unterhaltsreform aus dem Jahre 2008 grundsätzlich bejaht. Es ging darum, eine zeitliche Befristung für Unterhaltszahlungen zu erwirken, obwohl durch den Ehevertrag ein unbefristeter Unterhaltsanspruch vereinbart wurde. Da durch die Unterhaltsreform nunmehr die Eigenverantwortung nach der Ehe im Vordergrund steht und eine Befristung des Unterhalts vorgesehen ist, kann in diesem Fall unter gewissen Umständen eine Abänderung des Vertrags erfolgen. Dies jedoch nur nach eingehender Prüfung der Lebenssituation beider Parteien.
Deutlich wird das in einem Urteil vom Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg vom 21.02.2012 – Az. 10 UF 253/11: Hat ein Ehepartner durch die Ehe gravierende Nachteile in Bezug auf seine Karrieremöglichkeiten (Kinderbetreuung statt Karriere) erfahren, so kann diesem auch ein unbefristeter Unterhaltsanspruch zuerkannt werden.
Es ist also nicht ohne Weiteres möglich, allgemeingültige und eindeutige Leitsätze aufzustellen, nach denen sich entscheidet, wann ein Antrag auf Abänderung von vertraglichen Regelungen erfolgreich ist. Es kommt vielmehr auf die Gesamtsituation an. Zwar sind die hier geschilderten Kriterien grundlegend für solche Entscheidungen – es ist jedoch immer der Einzelfall mit allen relevanten Details zu betrachten.
Bevor Sie einen Ehevertrag aufsetzen, sollten Sie sich umfassend von einem Anwalt beraten lassen. Entscheidend für einen gültigen Ehevertrag ist nicht nur die Beglaubigung durch einen Notar, sondern auch die Übereinstimmung Ihrer momentanen Situation und Ihrer Eheplanung mit den vertraglichen Vereinbarungen. Der Ehevertrag kann auch auf etwaige Eventualitäten zugeschnitten werden, um spätere Ärgernisse und Streitigkeiten zu vermeiden. In einer persönlichen Beratung können Sie herausfinden, welche Möglichkeiten Ihnen bei der Vertragsgestaltung offen stehen und welche davon sich speziell für Ihre eheliche Situation anbieten.
Im Rahmen einer gerichtlichen Prüfung können Unterhaltsansprüche auch trotz entsprechender Vereinbarungen im Ehevertrag geltend gemacht werden. Ob das in Ihrem Fall wahrscheinlich ist oder nicht, können Sie durch eine persönliche Beratung gemeinsam mit Ihrem Anwalt eruieren. Nur durch eine detaillierte Schilderung Ihres Falls können Sie treffende Antworten für Ihre individuelle Lage erhalten. Daraus ergibt sich dann der weitere Weg von selbst. Kennt Ihr Anwalt erst einmal Ihre genauen Umstände und Anliegen, ist bereits eine gute Ausgangsbasis für gerichtliche Verhandlungen gegeben, damit Ihre Interessen geltend gemacht werden können.
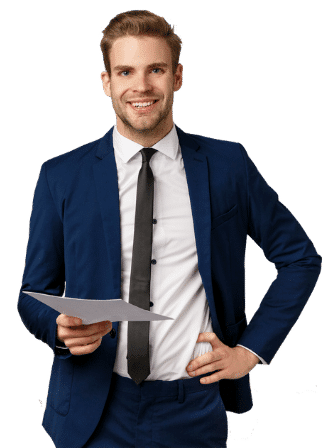
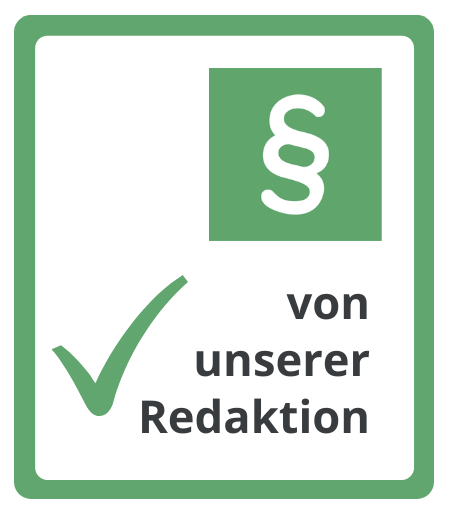
Unsere juristische Redaktion erarbeitet jeden Artikel nach strengen Qualitätsrichtlinien hinsichtlich Inhalt, Verständlichkeit und Aufbereitung der Informationen. Auf diese Art und Weise ist es uns möglich, Ihnen umfassende Informationen zu unterschiedlichsten Rechtsthemen zu bieten, die jedoch lediglich eine erste Information darstellen und keine anwaltliche Beratung ersetzen können.
Wenn Sie dieses YouTube/Vimeo Video ansehen möchten, wird Ihre IP-Adresse an Vimeo gesendet. Es ist möglich, dass Vimeo Ihren Zugriff für Analysezwecke speichert.
Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung
[finditoo-listing-email-link]