Durch einen Ehevertrag können Ehepaare laut § 1415 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) den Güterstand der Gütergemeinschaft vereinbaren.
Der Güterstand gibt vor, in welchem Verhältnis die Vermögen der Eheleute zueinander stehen – er bildet nicht nur die vermögensrechtliche Grundlage für die Zeit der Ehe – der Güterstand entscheidet auch im Falle einer Scheidung oder bei einem Todesfall, welcher Anteil dem Ehegatten am Vermögen bzw. Nachlass des anderen zukommt.
Der Güterstand der Gütergemeinschaft zeichnet sich dadurch aus, dass das jeweilige Vermögen der Ehepartner laut § 1416 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) zu gemeinschaftlichem Vermögen („Gesamtgut“) wird. Das betrifft sowohl das Vermögen, das die Ehegatten vor der Eheschließung besaßen, als auch das Vermögen, das die Partner im Laufe der Ehe erwirtschaften. Jedoch gibt es auch zwei weitere Vermögensmassen, die den Ehegatten jeweils alleine zustehen und welche diese selbstständig verwalten. Das ist zum Einen das durch § 1417 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) definierte Sondergut, womit alle Gegenstände gemeint sind, die nicht durch Rechtsgeschäfte übertragen werden können. Zum Anderen verfügt jeder Ehegatte gemäß § 1418 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) über ein Vorbehaltsgut, das im Ehevertrag festgelegt werden kann. Auch Schenkungen und Erbschaften können zum Vorbehaltsgut zählen – entweder durch eine entsprechende Klausel im Ehevertrag oder durch ausdrücklichen Wunsch des Erblassers oder Schenkenden.
Bei Beendigung der Gütergemeinschaft – sei es durch Scheidung oder Tod eines Ehegatten – findet gemäß § 1471 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) eine Auseinandersetzung über das Gesamtgut statt. Währenddessen bleibt die sogenannte Gesamthandsgemeinschaft aufrecht – das heißt: Der verbliebene Ehegatte und die anderen Erben können nicht über ihren Anteil am Vermögen bzw. Erbe verfügen, bis die Auseinandersetzung abgeschlossen ist. Das Ziel der Auseinandersetzung ist es, die durch die Gütergemeinschaft miteinander verschmolzenen Vermögensstände der Eheleute zu separieren, sodass wieder zwei getrennte Vermögensstände vorliegen. Erst dann steht fest, welches Vermögen der Verstorbene Ehegatte für seine Erben hinterlässt.
Im Rahmen der Auseinandersetzung sind laut § 1475 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) zunächst sämtliche Verbindlichkeiten bezüglich des Gesamtguts zu berichtigen. Ist dies nicht möglich, so sind Vermögenswerte au s dem Gesamtgut zu veräußern. Sobald alle Verbindlichkeiten berichtigt wurden, kann das Gesamtgut aufgeteilt werden. Der verbliebene Ehegatte erhält die ihm zustehende Hälfte des Gesamtguts. Der Anteil des Verstorbenen am Gesamtgut – also die andere Hälfte des Gesamtguts – fällt laut § 1482 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) in den Nachlass. Von diesem erhält der Ehegatte seinen Erbanteil – die Höhe der Erbschaft richtet sich danach, ob Verwandte des Erblassers vorhanden sind und welches Verwandtschaftsverhältnis zwischen diesen besteht.
Es steht für die Ehegatten außerdem laut § 1483 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) die Möglichkeit zur Verfügung, im Ehevertrag eine sogenannte fortgesetzte Gütergemeinschaft zu vereinbaren. In dem Fall wird die Gütergemeinschaft von dem überlebenden Gatten zusammen mit den gemeinschaftlichen Abkömmlingen, die durch die gesetzliche Erbfolge als Erben gelten, weitergeführt. Bei einer fortgesetzten Gütergemeinschaft fällt der Anteil des verstorbenen Gatten am Gesamtgut nicht in den Nachlass.
Haben die Eheleute in einer Gütergemeinschaft gelebt und wird diese zum Beispiel durch den Tod eines Ehegatten beendet, dann erfolgt zunächst eine Auseinandersetzung des Gesamtguts. Diese Auseinandersetzung ist der Vermögensauseinandersetzung im Scheidungsfall ähnlich. Zuallererst muss das Gesamtgut der Eheleute wieder getrennt werden – die Erbschaft beläuft sich nämlich nur auf die Hälfte des Gesamtguts, während die andere Hälfte in einer Gütergemeinschaft ja dem verbliebenen Ehepartner gehört.
Um die Teilung des Gesamtguts vorzunehmen, erfolgt zunächst die Ermittlung der Vermögenswerte und der Verbindlichkeiten bzw. Schulden in Bezug auf das Gesamtgut. Der Ehegatte und die anderen Erben verwalten das Gesamtgut einstweilen gemeinsam. Erst dann, wenn die Verbindlichkeiten in Bezug auf das Gesamtgut berichtigt wurden und demzufolge feststeht, welche Vermögenswerte dem verbliebenen Ehepartner gehören und welche dem Verstorbenen gehören und somit in den Nachlass fallen, kann das Erbe unter den Erbberechtigten aufgeteilt werden.
In komplizierten Fällen kann das durchaus zu Streitigkeiten führen – alle Erben müssen gemeinsam entscheiden, wie die Schulden beglichen werden sollen und welche Vermögenswerte gegebenenfalls zu diesem Zweck veräußert werden sollen. Außerdem ist eine Aufteilung nicht immer einfach, so es sich nicht nur um Geldwerte handelt: Wenn sich zum Beispiel Immobilien im Nachlass befinden, müssen diese unter Umständen veräußert werden – bei Uneinigkeit zwischen den Erben kann es auch zu einer Zwangsversteigerung kommen. Wenn das Gesamtgut schließlich zur Teilung bereitsteht, erhält jeder Erbe den ihm davon zustehenden Erbanteil. Zudem fällt auch das Sondergut und das Vorbehaltsgut des verstorbenen Ehepartners in den Nachlass. Diese werden zusätzlich zum verbleibenden Gesamtgut unter den Erben aufgeteilt. Im folgenden Abschnitt erfahren Sie, zu welchen Teilen die Erbberechtigten am Erbe beteiligt werden.
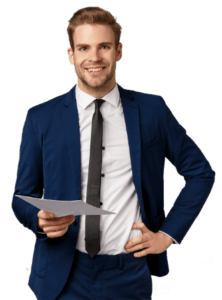
Der Güterstand hat einen Einfluss auf das Erbrecht und somit auf den Anteil, der einem Ehepartner beim Tod seines Partners an der Erbschaft zukommt. Er bestimmt, wie viel ein Ehegatte neben den Verwandten des Verstorbenen erbt. Für Erbschaften gilt allgemein: Wenn der Verstorbene kein Testament und keinen Erbvertrag aufgesetzt hat, dann wird die Erbschaft nach den allgemein gültigen Vorgaben abgewickelt. Zu beachten ist dabei jedoch, dass das Erbrecht einen Pflichtteil für bestimmte Erben vorsieht. So kann man zwar als direkter Nachkomme bzw. enger Verwandter durch ein Testament enterbt werden – auch in solchen Fällen kann jedoch der Pflichtteil am Erbe, also ein festgesetzter Mindestanteil – beansprucht werden. Liegt kein Testament oder Erbvertrag seitens des verstorbenen Ehegatten vor, dann ist die Erbfolge bei Gütergemeinschaft folgendermaßen geregelt:
Wie bei einer Scheidung besteht auch im Todesfall eines Ehegatten die Möglichkeit, bestimmte Gegenstände, die einen persönlichen Wert darstellen, aus dem Gesamtgut zu übernehmen. Dieses Übernahmerecht kann sowohl vom Ehepartner als auch von den anderen Erben geltend gemacht werden. Möchte ein Erbe bestimmte Gegenstände aus dem Gesamtgut übernehmen, dann muss er den Wert entsprechend ersetzen.
Des Weiteren gibt es für den verbliebenen Ehegatten die Option, den sogenannten Voraus zu beanspruchen. Auf diese Weise kann er Gegenstände aus dem gemeinsamen Haushalt wie zum Beispiel Küchenutensilien, Einrichtungsgegenstände und ähnliches zusätzlich zu seinem Erbanteil erhalten. Teilt er sich das Erbe mit Kindern oder Enkeln des Verstorbenen (Verwandten erster Ordnung), so kann er den Voraus nur insofern beanspruchen, als er auf diese Gegenstände für die Führung des Haushalts angewiesen ist und selbst über ein ausreichendes Vermögen verfügt um diese finanzieren zu können. Neben Verwandten zweiter und dritter Ordnung kann der verbliebene Ehegatte den Voraus uneingeschränkt in Anspruch nehmen. Der Voraus kann übrigens nicht nur in einer Gütergemeinschaft, sondern auch in allen anderen Güterständen geltend gemacht werden.
Durch einen Ehevertrag kann auch die sogenannte fortgesetzte Gütergemeinschaft vereinbart werden. In dem Fall besteht die Gütergemeinschaft auch nach dem Todesfall eines Gatten weiter und wird zwischen dem verbliebenen Ehegatten und den aus der Ehe hervorgegangenen Abkömmlingen fortgeführt. Der Anteil des Verstorbenen am Gesamtgut wird nicht aufgeteilt. Lediglich das Sondergut und das Vorbehaltsgut fallen in den Nachlass. Eine fortgesetzte Gütergemeinschaft zu vereinbaren, ist vor allem dann sinnvoll, wenn das Gesamtgut erhalten bleiben soll und man vermeiden möchte, dass es im Todesfall eines Gatten zu Auseinandersetzungen zwischen den Erben kommt. Der verbliebene Ehegatte hat jedoch das Recht, die Fortsetzung der Gütergemeinschaft abzulehnen.
In einer Zugewinngemeinschaft hat der Ehepartner zusätzlich zur Erbschaft auch ein Recht auf den sogenannten Zugewinnausgleich. Dieser beträgt ein Viertel des Erbes und kann unabhängig vom tatsächlich erwirtschafteten Zugewinn beansprucht werden. Erbschaftssteuer fällt für den Zugewinnausgleich keine an. In einer Zugewinngemeinschaft erhöht sich der Anteil des Ehegatten am Erbe insgesamt auf die Hälfte des Erbes – auch dann, wenn Kinder des Erblassers als Miterben vorhanden sind. Im Hinblick auf das Erbrecht ist die Zugewinngemeinschaft also vorteilhafter für die Ehegatten.
Ehepartner, die keinen Ehevertrag abgeschlossen haben, leben übrigens automatisch in einer Zugewinngemeinschaft. Außerdem gibt es noch den Güterstand der Gütertrennung. Diesen können die Ehegatten (wie auch die Gütergemeinschaft) nur durch einen Ehevertrag festlegen. In dem Fall erbt der verbliebene dann, wenn nur ein Kind, Verwandte zweiter Ordnung oder Großeltern vorhanden sind, die Hälfte. Bei zwei Kindern hat der Ehegatte das Recht auf ein Drittel des Erbes. Ab drei Kindern steht ihm ein Viertel zu.
Die Auseinandersetzung einer Gütergemeinschaft kann ziemlich kompliziert sein. Informieren Sie sich am besten ausführlich über die Konsequenzen dieses Güterstands. Entscheiden Sie sich dennoch dafür, empfiehlt es sich, in einer anwaltlichen Beratung abzuklären, welche Möglichkeiten bestehen, um unerwünschten Nachteilen entgegenzuwirken. Nicht nur im Ehevertrag lassen sich spezifische Regelungen treffen, womit spätere Konflikte vermieden werden können – durch ein Testament können Sie genau festlegen, was mit Ihrem Vermögen im Todesfall passiert. Für ein Testament sollten Sie einen spezialisierten Anwalt für Erbrecht aufsuchen. Dadurch können Sie Ihren letzten Willen klar definieren und ersparen etwaigen Erben langwierige Gerichtsverfahren.
Konflikte lassen sich jedoch nicht immer komplett vermeiden – sie können jedoch unter Umständen abgeschwächt werden. Dabei kann ein kompetenter Ansprechpartner unterstützend sein. Mit Hilfe eines Anwalts können Sie die rechtlichen Grundlagen und mögliche Vorgehensweisen abklären, wodurch Sie auch einer sehr spannungsgeladenen Situation schon etwas gelassener entgegenblicken können. Ein Aufzeigen verschiedener Perspektiven und Möglichkeiten kann Sie dabei unterstützen, bedachter vorzugehen – was letztendlich zum Vorteil für alle Beteiligten gereichen kann.
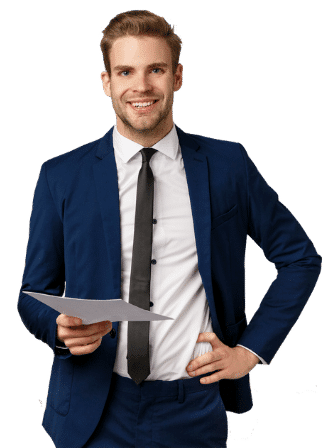
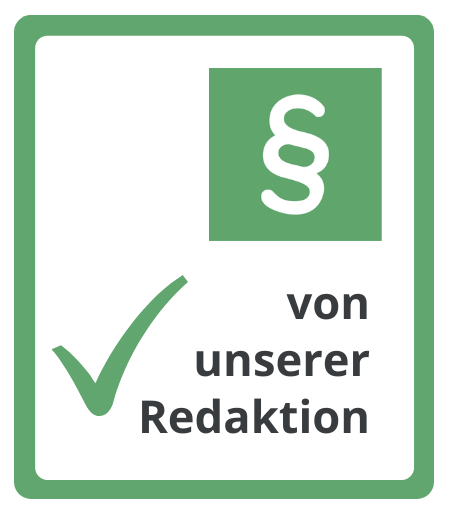
Unsere juristische Redaktion erarbeitet jeden Artikel nach strengen Qualitätsrichtlinien hinsichtlich Inhalt, Verständlichkeit und Aufbereitung der Informationen. Auf diese Art und Weise ist es uns möglich, Ihnen umfassende Informationen zu unterschiedlichsten Rechtsthemen zu bieten, die jedoch lediglich eine erste Information darstellen und keine anwaltliche Beratung ersetzen können.
Wenn Sie dieses YouTube/Vimeo Video ansehen möchten, wird Ihre IP-Adresse an Vimeo gesendet. Es ist möglich, dass Vimeo Ihren Zugriff für Analysezwecke speichert.
Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung
[finditoo-listing-email-link]