Die Prozesskostenhilfe – im Familienrecht Verfahrenskostenhilfe genannt – soll all Jenen zukommen, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Lage die Kosten für ein Verfahren (Scheidungsverfahren) nicht selbst tragen können. Sie umfasst neben den Gerichtskosten auch die Anwaltskosten und wird auf Antrag gewährt. Im nun folgenden Artikel möchten wir Ihnen aufzeigen, wofür die Prozesskostenhilfe gedacht ist, welche Voraussetzungen für die Inanspruchnahme erfüllt sein müssen und wie die Beantragung und Rückzahlung erfolgt.
Grundsätzlich muss an dieser Stelle gesagt werden, dass diese beiden Begrifflichkeiten das Gleiche bedeuten: seitdem Familiensachen vor dem Gericht nicht mehr als Prozess, sondern als Verfahren gelten, spricht man auch anstelle der Prozesskostenhilfe von der Verfahrenskostenhilfe. Das soll dem Umstand Rechnung tragen, dass es in Familiensachen nicht immer um “Streitigkeiten” geht, sondern eine Verhandlung mit dem Ergebnis einer Lösung anzustreben, mit der alle Beteiligten gut leben können. Umgangssprachlich wird die Verfahrenskostenhilfe auch häufig Gerichtskostenhilfe genannt. Das ist zwar nicht per se falsch, kann Sie aber hinters Licht führen. Tatsächlich sind nämlich nicht nur die Gerichtsgebühren, sondern auch die Anwaltskosten umfasst.
Ziel der Verfahrenskostenhilfe im Familienrecht oder Prozesskostenhilfe im Allgemeinen ist es, ein nötiges Verfahren trotz eingeschränkter finanzieller Mittel führen zu können. Der Gesetzgeber hat mit diesem Unterstützungsmittel also die Grundlage dafür geschaffen, dass jeder Bürger, unabhängig von seiner wirtschaftlichen Finanzlage, ein Verfahren vor Gericht führen kann. Im Zusammenhang mit einem Scheidungsbegehren lässt sich vereinfacht sagen: Niemand soll eine gescheiterte Ehe fortführen müssen, weil er sich die Scheidung nicht leisten kann.
Der Anspruch auf Verfahrens- oder Prozesskostenhilfe wird grundsätzlich nicht von Amtswegen überprüft. Eine Antragstellung ist daher zwingend nötig, um diese finanzielle Unterstützungsleistung für Verfahren vor einem Gericht in Anspruch nehmen zu können.
Einen Anspruch auf die Prozesskosten- oder Verfahrenskostenhilfe hat man nur, wenn die finanziellen Möglichkeiten die Übernahme der Verfahrenskosten nicht ermöglicht. Entsprechend sind das Einkommen des Antragstellers wie auch dessen finanzielle Verpflichtungen und nötigen Ausgaben Grundlage des Anspruchs. Die Berechnung des Einkommens und somit der des einzusetzenden Vermögens für das Verfahren ist die Grundlage für einen möglichen Anspruch. Denn aus dem einzusetzenden Vermögen wird ein Wert ermittelt, der konkret angibt, ob die Verfahrenskostenhilfe in Form einer Vorschusszahlung oder einer rückzahlungsfreien Unterstützungsleistung gewährt wird.
Bei einem Vorschuss der Prozesskosten muss der Antragsteller den gewährten Kostenvorschuss nach Abschluss des Verfahrens in monatlichen Raten zurückzahlen. Ergibt die Anspruchsberechnung, dass die wirtschaftlichen Möglichkeiten selbst das nicht zulassen, wird eine rückzahlungsfreie Prozesskostenhilfe gewährt und der Antragsteller muss diese nicht zurück zahlen.
Der Gesetzgeber hat klar geregelt, wer in Deutschland einen Anspruch auf Prozesskostenhilfe hat. Geregelt ist dieser Anspruch im § 114 ff. Zivilprozessordnung (ZPO), in dem festgelegt wird, dass eine Partei dann Anspruch hat, wenn diese aufgrund ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse einen Prozess nicht, nur zum Teil oder lediglich in Form von Ratenzahlung finanzieren kann. Das Familienrecht bezieht sich im §74 FamFG klar auf diese Regelung der Prozesskostenhilfe. Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme sind somit:
Aussicht auf Erfolg hat das Verfahren, wenn die gesetzlichen Bestimmungen vollumfänglich eingehalten wurden. Bei einer Scheidung ist das namentlich vor allem das Trennungsjahr. Ist dieses noch nicht verstrichen, so hat Ihr Scheidungsantrag keine Aussicht auf Erfolg (Ausnahme: Härtefallscheidung) und die Verfahrenskostenhilfe wird vorerst abgelehnt.
Entscheidender als die die Begriffsbestimmung (Prozesskostenhilfe oder Verfahrenskostenhilfe) an sich, ist die Berechnung des Einkommen als Grundlage für einen möglichen Anspruch. Hier wird nämlich nicht einfach Ihr Einkommen genutzt, sondern es kommt zu einer Verrechnung unterschiedlichster Faktoren. Ziel ist es die tatsächliche Leistbarkeit eines Verfahrens unter Berücksichtigung von Einkommen und Ausgaben des Antragstellers zu ermitteln.
Grundlage für die Berechnung bildet natürlich Ihr regelmäßiges Einkommen. Das ist der Betrag, der Ihnen monatlich grundsätzlich zur Verfügung steht. Zu Ihrem Einkommen aus einer Erwerbstätigkeit werden auch alle zusätzlichen Einkommensansprüche einberechnet. Zusätzliches Einkommen kann in diesem Fall mitunter sein:
Sollten Sie kein regelmäßiges Einkommen haben, so wird der Durchschnitt des letzten Jahres herangezogen. Dafür werden die einzelnen Einkommen der Monate addiert und durch 12 geteilt. Haben Sie einen Anspruch auf Unterhalt gegenüber Ihrem Ehegatten, so wird dieser dem Einkommen hinzugerechnet. Das gilt auch dann, wenn der Anspruch besteht, der Unterhalt von Ihnen aber freiwillig nicht betrieben wird.
Bei der Prozesskostenhilfe gelten allgemein gemäß § 115 Abs. 1 ZPO folgende Freibeträge:
| Grundbetrag für Antragsteller und Ehegatten | je 619€ |
| Freibetrag bei Erwerbstätigkeit | 282€ |
| Freibetrag für Kinder bis 6 Jahre | 393€ |
| Freibetrag für Kinder von 7-14 Jahren | 429€ |
| Freibetrag für Kinder von 15-18 Jahren | 518€ |
| Freibetrag für Erwachsene im Haushalt | 496€ |
Nachdem das Gesamteinkommen ermittelt wird, werden die laufenden Ausgaben ermittelt und vom Gesamteinkommen abgezogen. Um diese Berechnung der monatlichen Ausgaben zu ermöglichen, müssen entsprechende Nachweise vorgelegt werden. Grundsätzlich unterscheidet der Gesetzgeber zwischen zulässigen Ausgaben für die Berechnung und sogenannten Luxusausgaben (also nicht zwingend nötigen Ausgaben) die nicht in die Berechnung einfließen können. Ausgaben die in jedem Fall einbezogen werden sind mitunter:
Zudem werden automatisch Pauschalwerte für den Lebensbedarf (Essen, Trinken etc.) angerechnet. Zudem gibt es Fallabhängig Freibeträge, die in die Berechnung einfließen. So kann der Antragsteller einen Freibetrag von 491 für sich selbst geltend machen, oder Freibeträge für Kinder angerechnet werden. Zu guter Letzt wird noch das Vermögen in die Berechnung eingeschlossen. Soweit dieses Vermögen als Verwertbar angesehen wird, schmälert dies den Anspruch auf Prozesskostenhilfe.
Nun kommen Sie auf einen Wert, der auch als “einzusetzendes Vermögen” bezeichnet wird. Dieser beschreibt Ihr Einkommen abzüglich der Ausgaben (z.B. Unterhalt) und Freibeträge für sich selbst oder für Ihre Kinder. Auch verwertbares Eigentum wurde eingerechnet. Das Ergebnis dieser Rechnung entscheidet darüber, ob und welche Art von Verfahrenskostenhilfe Ihnen zusteht:
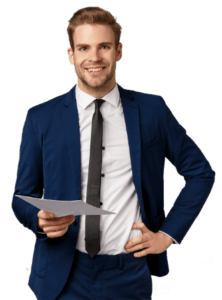
Um einen gerechtfertigten Anspruch auf Prozesskostenhilfe / Verfahrenskostenhilfe im Zuge einer Scheidung wahrnehmen zu können, müssen Sie einen Antrag auf Verfahrenshilfe beim zuständigen Familiengericht stellen. Mit diesem Antrag müssen Sie zudem eine Erklärung über Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse abgeben und diese nachweisen. Beachten Sie, dass auch nach Ihrer Rechtsschutzversicherung gefragt wird.
Diese übernimmt häufig einen Großteil der Scheidungskosten und somit haben Sie keinen Anspruch auf die staatliche Verfahrenskostenhilfe. Nur dann, wenn die Rechtsschutzversicherung nicht zahlt, kann ein solcher Anspruch bestehen. Machen Sie hier unrichtige Angaben, um die Behörde bzw. das Gericht zu täuschen, so machen Sie sich möglicherweise eines Betruges schuldig.
Musterformulare für die Antragsstellung finden Sie auf den Webseiten der Justizbehörde des Bundeslandes, in welchem Sie leben und in welchem das Scheidungsverfahren stattfinden soll.
Diese Frage lässt sich pauschal nur schwer beantworten. Es kommt darauf an, ob Sie von Beginn an alle notwendigen Unterlagen eingereicht haben oder ob das Gericht noch etwas nachfordern muss. Außerdem gibt es Zeiten, in welchen die Verwaltung schneller agiert und Zeiten, in welchen viele Verfahren für großen Stress und teilweise Überlastung sorgen. Denken Sie in jedem Fall daran die Prozesskostenhilfe rechtzeitig zu beantragen. Im Zweifel ist nicht davon auszugehen, dass Sie innerhalb von einer Woche eine verbindliche Zu- oder Absage erhalten.
Eine der am häufigsten gestellten Fragen ist, ob die Prozesskostenhilfe die Scheidung quasi “kostenlos” macht. In machen Fällen mag das de facto der Fall sein, häufig ist es aber so, dass die Hilfe gewährt, aber an eine Bedingung geknüpft wird: Sollte sich Ihre persönliche und finanzielle Situation innerhalb von vier Jahren nach rechtskräftiger Scheidung verbessern, so müssen Sie dies der Behörde offenlegen. Sie haben dahingehend sogar eine Informationspflicht. In diesen Fällen ist es dann durchaus denkbar, dass die Verfahrenskostenhilfe in Raten vom Deutschen Staat zurückgefordert werden kann.
Davon sollten Sie sich jedoch nicht abschrecken lassen. Sind Sie beispielsweise derzeit arbeitslos und können sich deshalb nicht scheiden lassen, sollten Sie nicht mit dieser Bürde leben müssen. Das Gericht prüft in der Regel einmal im Jahre Ihre Einkommen und setzt dann ggf. eine zinslose Rückzahlung fest. Das ist sogar dann möglich, wenn Sie Hartz IV / ALG II beziehen. Nach 48 Monaten (vier Jahren) erlischt der Rückzahlungsanspruch automatisch und Sie können nicht mehr verpflichtet werden.
Verfahrenskostenhilfe zu beantragen erfordert ein gewisses Know-How, Geduld und vor allem Sorgfalt. Sie müssen vielfältige Unterlagen einreichen und Ihre Ausgaben belegen. Nur so kann Ihnen Prozesskostenhilfe gewährt werden. Ihr Anwalt, der Sie auch in der Scheidungssache vertritt, wird Sie bei der Beantragung unterstützen. Er prüft außerdem gemeinsam mit Ihnen im Voraus, ob ein solcher Antrag überhaupt Aussichten auf Erfolg hat. Ist das einzusetzende Vermögen beispielsweise extrem hoch und Sie möchten einfach nicht für die Scheidung zahlen, so können Sie sich den Aufwand für den Antrag sparen. Auf der anderen Seite unterstützt Ihr Anwalt Sie bei der Durchsetzung, wenn alle Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Schlussendlich hat der Anwalt selbst ein Interesse daran, dass die Verfahrenskostenhilfe bewilligt wird, da auch sein Honorar auf diesem Wege gesichert wird.
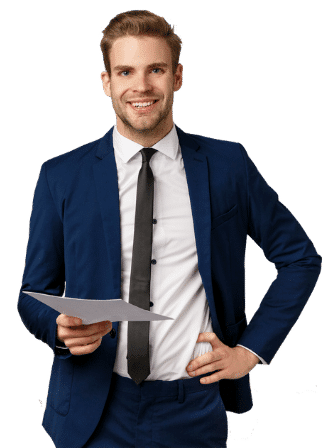
Verfahrenskostenhilfe kann entweder rückzahlungsfrei gewährt werden (selten) oder mit der Option auf eine Rückforderung, wenn sich die persönliche, finanzielle Situation des Antragstellers innerhalb von vier Jahren verbessert. Sie haben die Pflicht das Gericht über solche Verbesserungen zu informieren und die bewilligte Hilfe muss dann regelmäßig in Raten zurückgezahlt werden. Zinsen fallen hierbei nicht an.
Die zwei Grundvoraussetzungen dafür, dass die Verfahrenskostenhilfe bewilligt wird, sind:
Außerdem darf die Prozesskostenhilfe nur dann beantragt werden, wenn das Verfahren auch dann angestrebt werden würde, würde die Hilfe nicht bewilligt werden. Bedeutet konkret: nur dann, wenn das Verfahren Ihnen wichtig ist und nicht lediglich ein finanzielles Interesse dahinter steckt, ist die Bewilligung vorgesehen.
Egal ob Sie Verfahrenskostenhilfe oder Prozesskostenhilfe für eine Scheidung oder ein anderes Verfahren / einen anderen Prozess in Anspruch nehmen: das Gericht überprüft Ihr Einkommen und Ihre Vermögenssituation jährlich in einem Zeitraum von vier Jahren. Ist diese Frist verstrichen, so erlischt der Anspruch und selbst wenn sich die finanziellen Verhältnisse danach verbessern, kann keine Rückzahlung mehr gefordert werden.
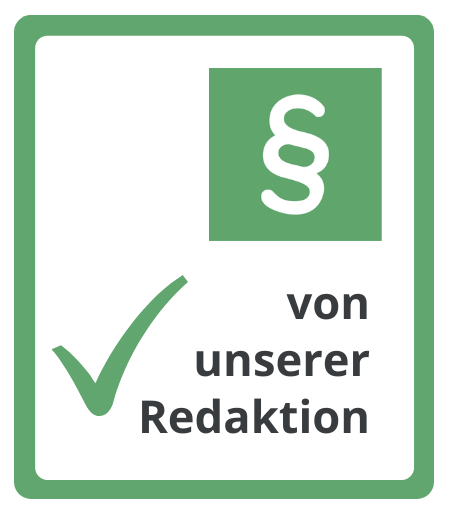
Unsere juristische Redaktion erarbeitet jeden Artikel nach strengen Qualitätsrichtlinien hinsichtlich Inhalt, Verständlichkeit und Aufbereitung der Informationen. Auf diese Art und Weise ist es uns möglich, Ihnen umfassende Informationen zu unterschiedlichsten Rechtsthemen zu bieten, die jedoch lediglich eine erste Information darstellen und keine anwaltliche Beratung ersetzen können.
Wenn Sie dieses YouTube/Vimeo Video ansehen möchten, wird Ihre IP-Adresse an Vimeo gesendet. Es ist möglich, dass Vimeo Ihren Zugriff für Analysezwecke speichert.
Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung
[finditoo-listing-email-link]