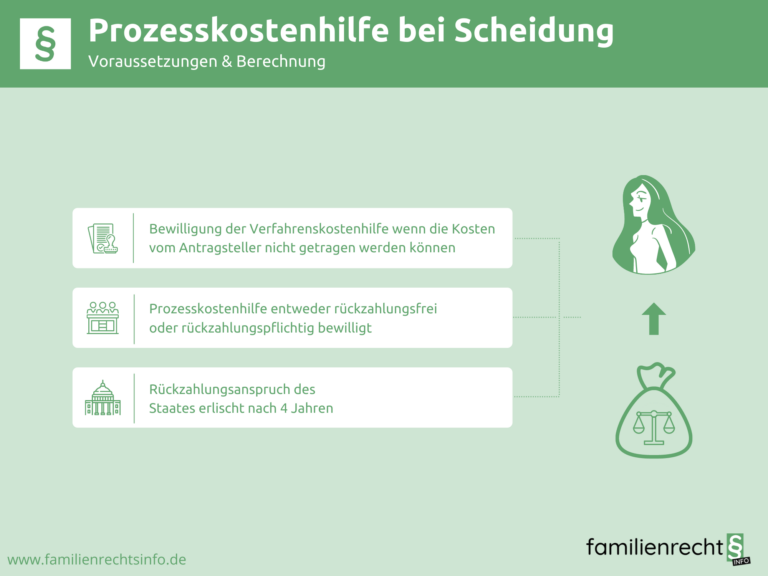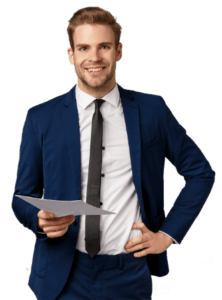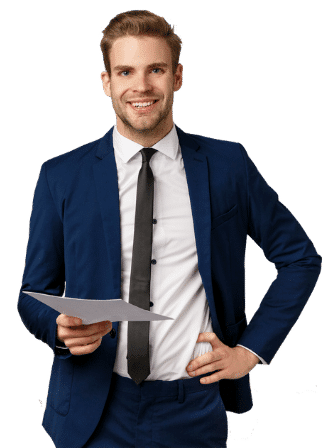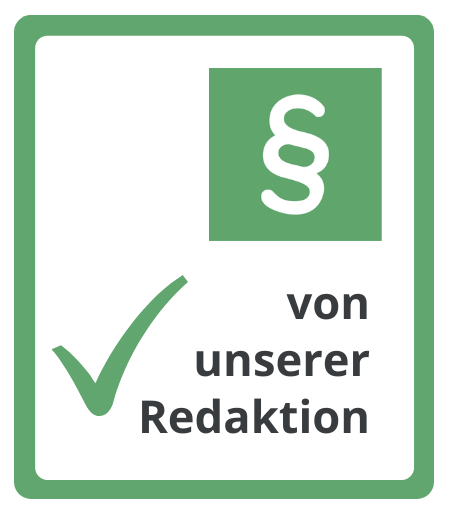Diese Webseite verwendet Cookies, die für einige Funktionen der Webseite notwendig sind oder zur Optimierung der Inhalte dienen (auch Inhalte von Fremdanbietern).
Die Cookies werden im Browser gespeichert.
Lesen Sie gerne auch mehr in unserer Seite zum Datenschutz
Sie können die Einstellungen anpassen, in dem Sie Navigation auf der linken Seite nutzen.