Eine Ehe kann nicht nur durch eine Scheidung sondern auch durch gerichtliche Auflösung beendet werden. Waren die Voraussetzungen für eine Ehe bei der Heirat nicht gegeben, dann kann eine Aufhebung der Ehe beantragt werden. Eine Annullierung der Ehe im eigentlichen Sinne, die dazu führt, dass die Ehe so gehandhabt wird, als hätte sie nicht existiert, ist in der derzeitigen Rechtslage nicht vorgesehen. Wann und wie Sie eine Ehe aufheben können und was dabei sonst noch zu beachten ist, erfahren Sie im folgenden Artikel.
Seit dem Jahr 1998 ist eine Annullierung der Ehe in Deutschland nicht mehr vorgesehen. Anstelle der Eheannullierung ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (kurz BGB) von einer Aufhebung der Ehe die Rede – die Paragraphen 1313 – 1318 widmen sich dieser Thematik.
Laut § 1313 im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) kann eine Ehe nur auf Antrag und durch richterliche Entscheidung aufgehoben werden. Sobald die Entscheidung rechtskräftig ist, gilt die Ehe als aufgelöst. Im Unterschied zu der Eheannullierung, die zu früheren Zeiten noch möglich war, ist eine Eheaufhebung also nicht rückwirkend gültig. Damals konnte eine Ehe durch Annullierung als nichtig erklärt werden – sie wurde damit so behandelt, als hätte die Eheschließung nicht stattgefunden.
Eine Aufhebung der Ehe ist nur möglich, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Die Voraussetzungen sind durch § 1314 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) geregelt. Dieser verweist wiederum auf die §§ 1303 ff des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) – diese legen fest, welche Voraussetzungen vorliegen müssen, damit eine Ehe wirksam geschlossen werden kann („Ehefähigkeit“). Demnach kann eine Ehe aufgehoben werden, wenn einer der Beteiligten die Ehe zu einem Zeitpunkt eingegangen ist, an welchem noch keine Ehemündigkeit gegeben war. Ist mindestens einer der beiden noch nicht volljährig, dann kann die Aufhebung der Ehe beantragt werden. Zudem kann eine Ehe dann aufgehoben werden, wenn einer der Beteiligten geschäftsunfähig ist.
Neben der Ehefähigkeit spielen auch Eheverbote eine Rolle. Gemäß § 1306 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) darf eine Person, die sich bereits in einer Ehe oder Lebenspartnerschaft mit einer dritten Person befindet, keine zusätzliche Ehe eingehen. Außerdem ist eine Ehe zwischen Verwandten laut § 1307 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) unzulässig. Das betrifft Verwandte in gerader Linie, Geschwister und Halbgeschwister, aber auch Verwandtschaftsverhältnisse, die durch Adoption begründet wurden.
Für eine wirksame Eingehung einer Ehe ist es außerdem laut § 1311 erforderlich, dass die Ehewilligen bei gleichzeitiger Anwesenheit und persönlich ihren Willen zur Eingehung der Ehe vor einem Standesbeamten erklären.
In § 1314 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) sind noch weitere Gründe, die zu einer Aufhebung der Ehe berechtigen können, wie zum Beispiel Bewusstlosigkeit eines Ehegatten oder Täuschung und Drohung, genannt. Auch eine Scheinehe ist aufhebbar. Im weiteren Text werden wir die einzelnen Aufhebungsgründe noch genauer erläutern. Je nachdem, welcher der Aufhebungsgründe vorliegt, liegt die Berechtigung für den Antrag auf eine Eheaufhebung laut § 1316 bei jeweils anderen Personen bzw. Stellen. Neben den Ehegatten selbst können auch Behörden oder (etwa bei einer Doppelehe) Dritte einen solchen Antrag stellen.
Auch die Fristen, die für die Antragstellung gelten, sind durch § 1317 BGB jeweils anders vorgegeben und können von 1 Jahr bis zu 3 Jahre (bei Drohung) betragen. Außerdem gelten für die unterschiedlichen Fälle auch unterschiedliche Folgen einer Eheaufhebung, die durch § 1318 BGB festgelegt sind. Hat zum Beispiel ein Ehegatte den anderen Partner durch Drohung oder Täuschung zur Eheschließung bewegt, so kann der Betreffende nach Aufhebung der Ehe unter Umständen Anspruch auf Unterhalt geltend machen.
Eine Annullierung der Ehe bedeutet, dass sie für ungültig erklärt wird. Zu früherer Zeit war es in Deutschland noch möglich, eine Ehe annullieren zu lassen und somit rückgängig zu machen. Die aktuelle Gesetzeslage verwendet den Begriff Annullierung nicht – genau genommen ist eine Annullierung der Ehe heutzutage auch nicht möglich. Statt der Eheannullierung kann jedoch eine Aufhebung der Ehe vorgenommen werden. Die Eheaufhebung ist jedoch nicht dasselbe wie eine Eheannullierung: Eine einmal eingegangene Ehe kann auch durch eine Aufhebung nicht rückgängig gemacht werden.
Da der Begriff Eheannullierung gemeinhin bekannter ist, wird dieser im folgenden Text verwendet – gemeint ist jedoch die auch heute noch mögliche Eheaufhebung, wie sie im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt ist. Es gibt unterschiedliche Verfahren, die in Hinsicht auf eine Ehe bzw. deren Auflösung eingeleitet werden können („Ehesachen“):
Eine Annullierung der Ehe stellt nur in Ausnahmefällen eine Alternative zur Scheidung dar. Eine Eheaufhebung kann also nur in ganz bestimmten Fällen vorgenommen werden. Im Allgemeinen ist dies dann möglich, wenn die Voraussetzungen für eine wirksame Eheschließung bei der Heirat nicht gegeben waren. Zu beachten sind dabei unter anderem die Kriterien der Ehefähigkeit und der Eheverbote. Für eine wirksame Ehe müssen beide Partner ehefähig sein und eine Ehe unter ihnen muss generell erlaubt sein.
Das Standesamt prüft vor einer Eheschließung zwar, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind – dennoch kann es vorkommen, dass Ehen geschlossen werden, wo sich erst im Nachhinein herausstellt, dass die Voraussetzungen dafür gar nicht vorlagen. Auch solche Ehen sind also gültig und können nur durch ein Scheidungs- oder (speziell in diesen Fällen) durch ein Aufhebungsverfahren beendet werden. Eine Ehe kann aus Gründen mangelnder Ehefähigkeit aufgehoben werden, wenn:
Eine Eheaufhebung aufgrund eines Eheverbots kann vorgenommen werden, wenn:
Des Weiteren kann eine Ehe bei Vorliegen der folgenden Gründe aufgehoben werden:
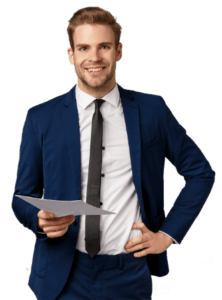
Um eine Ehe zu annullieren ist ein Antrag samt Begründung beim zuständigen Familiengericht notwendig. Die Begründung alleine ist jedoch nicht ausreichend, sie muss vor Gericht auch glaubhaft gemacht werden können. Liegen also keine aussagekräftigen Beweise vor, kann es zielführender sein, die Ehe nicht annullieren zu lassen, sondern stattdessen die Scheidung zu beantragen.
Wer den Antrag auf Aufhebung der Ehe stellen darf, kann je nach Aufhebungsgrund anders geregelt sein. In vielen Fällen sind die beiden Ehepartner als auch Behörden (zum Beispiel das Standesamt) antragsberechtigt – nämlich dann, wenn :
Handelt es sich um eine Doppelehe, dann kann zudem auch die Person, die sich bereits in einer Ehe oder Lebenspartnerschaft mit einem der Gatten befindet, beantragen, dass die Ehe aufgehoben werden soll. Wurde eine Ehepartner durch Unwissenheit, arglistige Täuschung oder Drohung zu der Eheschließung bewegt, dann hat die Antragstellung von diesem zu erfolgen.
Möchten Ehepartner eine Ehe annullieren lassen, fallen ebenso die Gerichtskosten für das Verfahren, als auch die Kosten für einen Anwalt an. Wie bei einer Scheidung besteht auch hier Anwaltszwang - das heißt, dass sich Anträge nur durch einen rechtlichen Vertreter stellen lassen. Wie hoch die Kosten letztlich sind, hängt jedoch sowohl bei Eheaufhebungs- als auch Scheidungsverfahren davon ab, wie umfangreich das Verfahren ist. Eine Ehe annullieren zu lassen ist also nicht unbedingt günstiger als eine Scheidung.
Um eine Ehe annullieren zu lassen, muss dies innerhalb der vorgegebenen Fristen beantragt werden. Auch hier sind je nach Aufhebungsgrund andere Vorgaben zu beachten. Sobald ein Ehepartner (oder im Falle der Geschäftsunfähigkeit eines Ehegatten der gesetzliche Vertreter) entdeckt hat, dass er aus Unwissenheit oder durch Täuschung eine Ehe eingegangen ist, hat er 1 Jahr lang Zeit, die Eheaufhebung zu beantragen. Wurde die Ehe aufgrund einer Drohung eingegangen, dann verlängert sich die Frist auf 3 Jahre nach dem Ende der Zwangslage.
Da die Aufhebung einer Ehe wie auch bei einer Scheidung nicht rückwirkend geltend gemacht werden kann, können auch in diesem Fall gewisse Folgen damit verbunden sein. So kann ein Ehegatte Anspruch auf nachehelichen Unterhalt haben, wenn dieser bei der Eheschließung nicht wusste, dass die Ehe aufhebbar ist oder er von seinem Ehepartner getäuscht oder bedroht wurde. Außerdem können im Falle einer Doppelehe oder einer Ehe zwischen Verwandten ebenfalls Unterhaltsansprüche bestehen, auch wenn die Ehepartner bei der Eheschließung wussten, dass die Ehe aufhebbar ist. Unterhaltsansprüche bei einer Doppelehe bestehen jedoch nur insoweit, als diese die Ansprüche des dritten Ehegatten nicht beeinträchtigen.
Auch bei gemeinsamen Kindern können Unterhaltsansprüche in Bezug auf deren Pflege oder Erziehung geltend gemacht werden. Haben die Ehegatten gemeinsame Kinder, so kann sich zudem die Frage nach dem Sorgerecht und dem Umgangsrecht stellen. Ebenso steht kann den Ehegatten ein Zugewinnausgleich und ein Versorgungsausgleich zustehen, so dies mit den Umständen bei der Eheschließung vereinbar ist – im Falle einer Doppelehe ist auch hier zu beachten, dass der bereits vor der Eheschließung bestehende Partner nicht durch die entsprechenden Ausgleichsansprüche benachteiligt wird.
Haben die Ehepartner zusammengelebt, dann können zudem Verhandlungen stattfinden, um festzulegen, wer in der Wohnung bleibt und wie der Hausrat aufgeteilt werden soll. Auch hier sind die Umstände bei der Eheschließung und (im Falle einer Doppelehe) die Belange des dritten Partners zu berücksichtigen. Verhandlungen zu den obengenannten Folgesachen werden nicht automatisch durchgeführt, sondern sind beim Familiengericht gesondert zu beantragen. Zudem kann das gesetzliche Erbrecht eines Ehegatten verfallen, so dieser bei der Eheschließung wusste, dass die Ehe aufhebbar ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Aufhebung der Ehe in Ihrem Fall möglich ist, dann sollten Sie dies mit einem Anwalt abklären. Zudem können Sie durch ein Beratungsgespräch eruieren, ob eine Eheaufhebung tatsächlich der beste Weg für Sie ist. Nur durch eine genaue Kenntnis der Sachlage lässt sich abschätzen, ob ein Verfahren zur Eheaufhebung Aussichten auf Erfolg hat oder ob sich in Ihrem Fall eher eine Scheidung empfiehlt.
Wofür Sie sich auch letztendlich entscheiden – möchten Sie ein solches Verfahren in Gang setzen und einen Antrag stellen, dann benötigen Sie auf alle Fälle einen Anwalt. Dieser unterstützt Sie bei der Vorbereitung auf das Verfahren und vertritt Sie anschließend auch vor Gericht, um dort die Gründe und Beweise für die Eheaufhebung überzeugend darzulegen. Neben dem Eheaufhebungsverfahren können unter Umständen auch Verfahren zu Folgesachen die Unterstützung durch einen Anwalt erfordern. Sie erfahren von diesem vorab, ob etwaige Ansprüche – zum Beispiel auf Unterhalt oder Zugewinnausgleich – bestehen und können diese mit seiner Hilfe geltend machen.
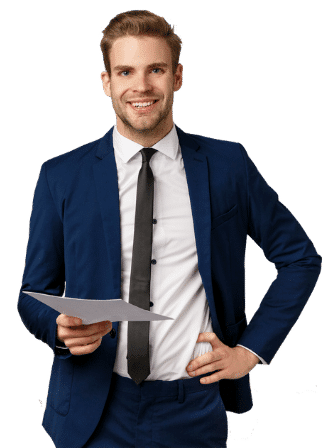
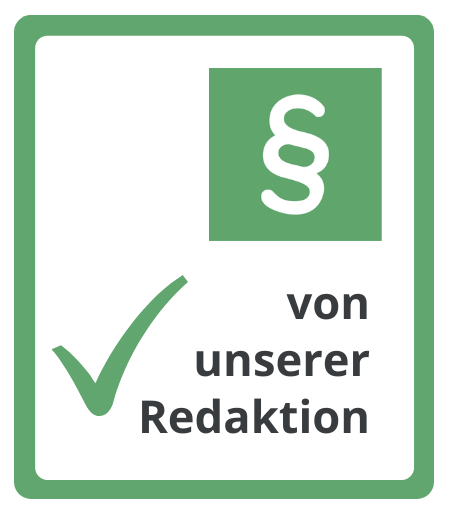
Unsere juristische Redaktion erarbeitet jeden Artikel nach strengen Qualitätsrichtlinien hinsichtlich Inhalt, Verständlichkeit und Aufbereitung der Informationen. Auf diese Art und Weise ist es uns möglich, Ihnen umfassende Informationen zu unterschiedlichsten Rechtsthemen zu bieten, die jedoch lediglich eine erste Information darstellen und keine anwaltliche Beratung ersetzen können.
Wenn Sie dieses YouTube/Vimeo Video ansehen möchten, wird Ihre IP-Adresse an Vimeo gesendet. Es ist möglich, dass Vimeo Ihren Zugriff für Analysezwecke speichert.
Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung
[finditoo-listing-email-link]