Das Umgangsrecht bezeichnet den gegenseitigen Anspruch auf Umgang zwischen einem Kind und seinen Eltern. Darüber hinaus hat das Kind ein Kontaktrecht zu weiteren wichtigen Bezugspersonen, wie den Großeltern, Geschwistern und Pflegeeltern. Nur unter gewissen Voraussetzungen kann das Umgangsrecht verweigert oder eingeschränkt werden. Als Wegweiser für alle Fragen zum Umgangsrecht, erläutert der folgende Beitrag Ihnen, wie oft ein Elternteil das Kind sehen darf, wie sich das Besuchsrecht gestaltet und unter welchen Bedingungen eine Umgangsverweigerung möglich ist.
Das Umgangsrecht wird im BGB (Bürgerlichen Gesetzbuch) geregelt und ist ein Bereich des Familienrechts. Es ist die rechtliche Grundlage für den Umgang des Kindes mit seinen Eltern und ist strikt vom Sorgerecht abzugrenzen.
Lebt das Kind nicht mit beiden Eltern zusammen, hat der nicht hauptsächlich betreuende Elternteil das Recht, Zeit mit dem Kind zu verbringen.
Das Umgangsrecht ist vom Sorgerecht abzugrenzen, da beide unterschiedliche Ziele verfolgen. Grundsätzlich betrachtet man das Sorgerecht und das Umgangsrecht unabhängig voneinander: Jeder Elternteil, auch ein nicht sorgeberechtigter Elternteil, hat ein Recht auf Umgang mit seinen Kindern. Das Sorgerecht betrifft alle Angelegenheiten, die das Leben eines Kindes betreffen und erläutert somit auch die Pflichten der Eltern für ihre Kinder:
Meist haben die Eltern ein gemeinsames Sorgerecht, da sie zum Zeitpunkt der Geburt verheiratet waren, nach der Geburt geheiratet haben, die Sorge gemeinsam übernommen haben oder das Familiengericht ihnen die elterliche Sorge gemeinsam übertragen hat. Nur in seltenen Fällen erhält ein Elternteil das alleinige Sorgerecht.
Waren beide Elternteile sorgeberechtigt, dann besteht soweit nicht anders geregelt, nach der Scheidung und Trennung die gemeinsame Sorge fort.
Nicht nur die Eltern und das Kind selbst haben ein Umgangsrecht, sondern auch weitere Personen dürfen vom Besuchsrecht Gebrauch machen. Da der Kontakt eines Kindes mit Personen, zu denen es eine enge Bindung aufgebaut hat, wichtig ist, sind auch folgende Personen umgangsberechtigt:
Die oben genannten Personenkreise gelten als enge Bezugspersonen des Kindes und haben ein Recht auf Kontakt mit dem Kind. Damit ihnen allerdings ein Umgangsrecht zugesprochen wird, muss eine sozial-familiäre Beziehung vorhanden sein, d.h., dass die Personen zum aktuellen Zeitpunkt oder in der Vergangenheit tatsächlich Verantwortung für das Kind übernommen haben.
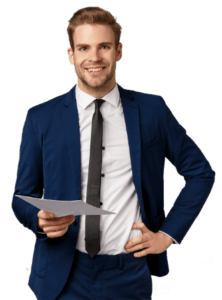
Grundsätzlich hat ein Vater Umgangsrecht mit seinem Kind. Doch was geschieht, wenn der nicht leibliche Vater des Kindes und die Mutter das gemeinsame Sorgerecht haben? Welches Besuchsrecht hat der biologische Vater? Der biologische Vater hat ebenfalls ein Umgangsrecht und darf mit dem Kind Kontakt haben, da laut Rechtsprechung das Kind eine natürliche, emotionale Beziehung zu seinem Vater hat.
Allerdings war dies nicht immer die rechtliche Auffassung, denn zuvor musste das Kind bereits eine persönliche Beziehung zum Vater aufgebaut haben, um Kontakt pflegen zu können. Verweigerte die Mutter damals den Kontakt, war es für den Vater meist schwierig, eine Beziehung aufzubauen. Seit 2013 reicht es aus, dass der Vater durch sein Verhalten zeigt, dass er Verantwortung für sein Kind übernehmen kann und möchte. Ein leiblicher Vater, der ernsthaftes Interesse an seinem Kind hat, hat ein Umgangsrecht, sofern der Umgang dem Kindeswohl dient.
Ebenso hat ein rechtlicher, nicht leiblicher Vater ein Umgangsrecht, der mit dem Kind längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft lebte. Da das Kind eine enge Beziehung zu dem Stiefvater aufbauen konnte, zählt dieser zu den näheren Bezugspersonen, die Verantwortung für das Kind übernommen haben. Jede engere Bezugsperson des Kindes hat ein Recht auf Umgang mit ihm. Das Gesetz erkennt die Beziehungen des Kindes zu Großeltern, Geschwistern und Stiefelternteilen im Rahmen des Besuchs- und Kontaktrechts an. Ferner kann auch eine Amme in Betracht gezogen werden. Im Notfall kann das Familienrecht den Umfang des Besuchsrechts bestimmen und die Rechte Dritter näher klären.
Das Kind hat grundsätzlich ein Recht auf Umgang mit Vater und Mutter, aber die Eltern müssen auch Pflichten beachten.
| Rechte | Pflichten | |
|---|---|---|
| Beide Elternteile | Die Eltern haben sowohl ein Recht als auch die Pflicht auf Umgang mit ihren Kindern. | Die Eltern haben sowohl ein Recht als auch die Pflicht auf Umgang mit ihren Kindern. |
| Umgangsberechtigtes Elternteil | Der Elternteil muss während des Umgangs Entscheidung treffen, die alltägliche Belange betreffen (Nahrung, Bettzeiten, Kleidung) und darf Ausflüge unternehmen oder Urlaube machen. | Die Kosten für Kindeskontakts tragen (Fahrtkosten, Verpflegung, Unterbringung) und den Besuch angenehm für das Kind im Sinne seiner Interessen gestalten. |
| Bei Urlauben im Ausland muss dies mit dem hauptsächlich betreuenden Elternteil abgesprochen werden; eine Zustimmung wird benötigt. | ||
| Elternteil mit elterlicher Sorge | Das Besuchsrecht des anderen Elternteils respektieren und das Kind für den Besuch vorbereiten. |
|
| Das Kind für den Kontakt mit dem anderen Elternteil begeistern und auf den Besuch einstimmen. |
Beim Besuchsrecht spricht man meist vom Umgang mit dem Kind in regelmäßigen, zeitlich begrenzten Besuchen, gemeinsamen Wochenenden, Reisen und Unternehmungen. Wer bestimmt beim Umgangsrecht? Wer zahlt die Fahrtkosten und wer trägt andere Kosten? Wer muss sich nach wem richten?
Die Ausgestaltung des Umgangsrechts ist nicht gesetzlich geregelt. Der Gesetzgeber geht grundsätzlich davon aus, dass sich die getrennten oder geschiedenen Eltern einvernehmlich über das Besuchs- und Kontaktrecht einigen und individuelle Umgangsvereinbarungen treffen, die dem Interesse des Kindes entsprechen. Wann und wie oft der Kontakt stattfinden soll, obliegt demnach den Vereinbarungen der Eltern und ist auch abhängig vom Alter des Kindes. Eine gängige Umgangsregelung ist meist die Folgende:
Können die Eltern keine Einigung finden, erfolgt eine Anhörung vor dem Familiengericht. Dieses entscheidet unter Berücksichtigung des Kindeswohls und nach Prüfung der bisherigen Gewohnheiten des Kindes, wie das Umgangsrecht zu regeln ist. Bei der Anhörung ist auch die Meinung des Kindes wichtig. Das Familiengericht stützt sich bei seinen Entscheidungen meist auf das Alter des Kindes: Je älter das Kind ist, desto länger kann der Besuch stattfinden. Als Orientierung dienen die folgenden Überlegungen:
Bei der Entscheidung der Familiengerichte ist vor allem auch der bisherige Umgang mit dem Vater während des Zusammenlebens entscheidend. War der Bezug nicht intensiv, wird ein regelmäßiger Kontakt infrage gestellt.
Am besten bestimmen die Eltern gemeinsam, denn dies entspricht dem Kindeswohl. Für jede Entscheidung der Eltern sollte das Wohl des Kindes im Fokus stehen. Man unterscheidet zwischen alltäglichen Entscheidungen und Entscheidungen, die für den Lebensweg des Kindes wichtig sind. Alltägliche Entscheidungen können unabhängig vom Sorgerecht allein getroffen werden, während sich das Kind beim umgangsberechtigten Elternteil aufhält. Entscheidungen erheblicher Bedeutung sind bei gemeinsamem Sorgerecht immer gemeinsam zu beschließen. Nur beim alleinigen Sorgerecht können diese Entscheidungen allein getroffen werden.
| alltäglichen Entscheidungen | Entscheidungen von erheblicher Bedeutung |
|---|---|
| Schul- und Lebensalltag | Anmeldung in Bildungs- und Erziehungseinrichtungen (Schule, Kindergarten) |
| Kleidung | Auswahl der Bildungseinrichtung |
| Nahrung | Ausbildung des Kindes |
| Regelung der Schlafenszeiten | Grundlegende religiöse Fragen und deren Erziehung |
| Umgang mit Freunden | Aufenthaltsbestimmung |
| Konsum und Nutzung elektronischer Geräte | Wichtige medizinische Behandlungen |
| Medizinische Versorgung (bei leichten Kinderkrankheiten und üblichen Behandlungen) | |
| Taschengeld | |
| Verwaltung des Vermögens und von Geldgeschenken |
Wie die Umgangsregeln aufgestellt werden, sollten die Eltern in Abstimmung mit den Freizeitaktivitäten des Kindes und ihrem Berufsleben festlegen. Nur im Streitfall ist das Familiengericht für das Aufsetzen einer Umgangsregelung zuständig. Ein optimales Modell gibt es nicht, allerdings sollten Sie die Umgangsvereinbarungen immer bestmöglich an die Bedürfnisse des Kindes anpassen. Im Rahmen des Umgangsrechts sollte auch die zumutbare Entfernung des Wohnsitzes des anderen Elternteils berücksichtigt werden und dementsprechend eine Regelung für den Umgang gefunden werden.
Je mehr Streit zwischen den Eltern herrscht, desto belastender ist dies für das Kind und desto wichtiger ist es, klare Umgangsregelungen zu treffen. Ferner müssen die Regelungen im Laufe der Zeit angepasst und auf das Alter der Kinder und ihre Bedürfnisse abgestimmt werden.
Sollten sie keine einvernehmliche Umgangsregelung aushandeln können, aber eine außergerichtliche Einigung wünschen, können Sie das örtliche Jugendamt um Hilfe bitten. Im gemeinsamen Gespräch wird versucht, eine Lösung zu finden. Ist dies nicht möglich, müssen Sie den gerichtlichen Weg gehen.
Bei der Festlegung der Umgangsregeln sollten Sie sich Gedanken zu den folgenden Aspekten und Fragen machen:
Dabei ist es auch wichtig, dass das Kind die Möglichkeit hat, das andere Elternteil an Weihnachten, an Ostern, anderen Feiertagen und an seinem Geburtstag zu sehen, sofern dies umsetzbar ist. Je älter das Kind ist, desto mehr Mitspracherecht sollte es bei den Umgangsregeln haben.
Der umgangsberechtigte Elternteil übernimmt die Kosten für die Fahrt und die Abholung des Kindes sowie jegliche Kosten, die mit dem Umgang in Verbindung stehen. Dies betrifft sowohl die Unterbringung, die Verpflegung als auch notwendige Kleidung, falls diese nicht vorhanden ist und benötigt wird. Grundsätzlich trägt der umgangsberechtigte Elternteil die Fahrtkosten und muss sich darum kümmert, dass das Kind abgeholt und zurückgebracht wird.
Haben die Eltern etwas anderes vereinbart, kann der betreuende Elternteil das Kind auch bringen und abholen. Wie sieht es mit der zumutbaren Entfernung beim Umgangsrecht aus? Leben die Elternteile weit voneinander entfernt und erlauben es seine wirtschaftlichen Verhältnisse nicht, die Kosten allein zu tragen, kann der andere Elternteil zur Mitwirkung aufgefordert werden.
Unter Umständen kann ein Elternteil das Umgangsrecht verweigern, allerdings ist dies nicht immer rechtmäßig. Denn eine Einschränkung oder ein Ausschluss des Kontaktrechts eines Elternteils zu seinem Kind ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Grundsätzlich ist es nur dann denkbar, wenn das Kindeswohl durch das Elternteil oder dessen Umfeld gefährdet ist. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn das Elternteil alkohol- oder/und drogenabhängig ist und sich in einem entsprechenden Umfeld aufhält, welches das Kind gefährdet.
Ebenso erfolgt ein Ausschluss des Umgangsrechts, wenn das Kind oder das andere Elternteil vom umgangsberechtigten Elternteil misshandelt wird. Unter Umständen wird im Rahmen eines begleitenden Umgangs den Eltern mithilfe eines Trägers des Jugendamts oder eines Vereins wie dem Kinderschutzbund ein neutraler und psychologisch ausgebildeter Betreuer gestellt, der den Umgangskontakt zwischen Kind und Elternteil begleitet. Der Umgang mit dem Kind darf nur von den zuständigen Behörden eingeschränkt oder ausgeschlossen werden, wenn das Kind in Gefahr ist und schwerwiegende Gründe vorliegen:
Wird oder wurde das Kind oder das andere Elternteil vom umgangsberechtigten Elternteil misshandelt, erfolgt in der Regel ein Ausschluss des Umgangsrechts. Der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs und die Ermittlungen der Polizei reichen allerdings nicht aus, um das Umgangsrecht bereits auszuschließen. Das Familiengericht muss den unter Prüfung des Tatverdachts und der bestehenden Gefahr einen Ausschluss oder eine Einschränkung abwägen.
Eine HIV-Infektion schließt das Umgangsrecht zum anderen Elternteil nicht aus. Bei einer ansteckenden Krankheit, bei der das Kind nicht vor der Ansteckung geschützt werden kann, erfolgen jedoch Einschränkungen bzw. Regelungen eines begleitenden Umgangs mit einem Arzt oder einer Krankenschwester.
Es müssen nachweisbare Anhaltspunkte für eine Entführungsgefahr vorliegen. Bevor ein Ausschluss des Umgangsrechts stattfindet, erfolgen jedoch andere Maßnahmen. Hierzu zählen die Passhinterlegung und eine Anordnung, dass der Kontakt nur im Inland erfolgen darf.
Ist die Betreuung des Kindes durch einen Alkohol- und/oder Drogenkonsum oder das Umfeld des Elternteils gefährdet, kann das Kontaktrecht mit Umgangsbegleitung eingeschränkt oder gänzlich ausgeschlossen werden.
Zeigt das Kind Auffälligkeiten wie zum Beispiel stark Stimmungsschwankungen oder Gereiztheit bei bestimmten Themen und stehen die Auffälligkeiten im Bezug zum anderen Elternteil, darf das Umgangsrecht ausgesetzt oder eingeschränkt werden. Insbesondere dann, wenn das Verhalten des anderen Elternteils dafür verantwortlich ist. Eine Alternative hierzu ist ein betreuter Umgang; besprechen Sie die Möglichkeiten mit dem Jugendamt.
Häufig kommt es vor, dass die Mutter dem Vater das Umgangsrecht verweigert. In einigen Fällen kann es hierfür Begründungen geben und bei anderen ist es lediglich ein Machtkampf zwischen den Elternteilen, der durch die Kontaktverweigerung zum Kind ausgetragen wird. Doch Vorsicht, denn eine grundlose Kontaktverweigerung zu dem Kind kann negative Auswirkungen haben. In schwerwiegenden Fällen kann dies zum Verlust des Aufenthaltsbestimmungsrechts des Elternteils führen und zur Sicherung des Umgangsrechts mithilfe eines Umgangspflegers führen. Versucht die Mutter mit dem Kind ins Ausland zu fliehen, um den Umgang mit dem Vater zu verhindern, kann dies zum Verlust des Sorgerechts führen. Des Weiteren kann eine konstante Verweigerung des Umgangs mit dem Kind auch Konsequenzen für den nachehelichen Unterhalt haben.
Auch bei Verdacht und wichtigen Gründen sollte man als Elternteil nicht sofort den Kontakt zum anderen Elternteil verweigern, sondern das Jugendamt kontaktieren, um sich ausführlich beraten zu lassen und die notwendigen rechtlichen Schritte einzuleiten.
Manchmal wünscht das andere Elternteil keinen Kontakt mehr zu seinen Kindern und verweigert daher selbst den Umgang. Ist dies rechtlich möglich? Verweigert das andere Elternteil den Kontakt zu seinem Kind, kann man ihn nicht zum Umgang zwingen. Selbst wenn das Kind ein Recht auf Umgang mit beiden Elternteilen hat, ist der Kontakt in diesem Fall nicht förderlich für das Kindeswohl. Wird der Elternteil zum Umgang gezwungen, dient dies kaum dem Wohl des Kindes.
Verweigert ihr Ex Partner den Umgang mit ihrem gemeinsamen Kind, dann sollten Sie unbedingt schnell handeln. Insbesondere jüngere Kinder können sich schnell entfremden, wodurch es schwieriger wird, das Besuchsrecht durchzusetzen.
Sollte Ihnen der Kontakt zu ihrem Kind verweigert werden, ist das Jugendamt oder der Kinderschutzbund die erste Anlaufstelle. Findet auch durch die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt oder dem Kinderschutz keine einvernehmliche Einigung statt, müssen Sie einen Anwalt für Familienrecht in Anspruch nehmen und beim Familiengericht einen Antrag stellen. Ein Anwalt setzt dann gerichtlich ihr Umgangsrecht durch. Da diese Verfahren langwierig sein können, empfiehlt sich die unmittelbare Beauftragung eines Anwalts, um Zeit zu sparen. Eine außergerichtliche Lösung steht an oberster Stelle, daher kann der Anwalt für Familienrecht auch mit dem gewissen Nachdruck, eine Einigung mit dem anderen Ehepartner erzielen.
Der Umgang zu ihrem Kind wird Ihnen nach wie vor verweigert, obwohl Sie Ihr Recht durch ein gerichtliches Urteil durchgesetzt haben? In diesem Fall drohen dem anderen Elternteil rechtliche Konsequenzen. Je nach Ausmaß des Vergehens können hierbei Zwangsgelder bzw. Ordnungsgelder vom Gericht angedroht und verhängt werden. Sollte der hauptsächlich betreuende Elternteil anschließend immer noch den Umgang verweigern, kann ihm sogar die Beantragung einer Zwangshaft drohen.
Das Familiengericht kann anordnen, dass ein Gerichtsvollzieher das Kind abholt und Ihnen übergibt. Als Eltern sollten Sie jedoch so vernünftig sein, dies zu unterlassen, denn die Abholung durch eine fremde Autoritätsperson ist nicht zum Wohl des Kindes. Ferner hat das Familiengericht die Möglichkeit dem Elternteil das Aufenthaltsbestimmungsrecht zu entziehen und an den umgangsberechtigten Elternteil zu übertragen, sofern ein gemeinsames Sorgerecht besteht. Hinzu kommt auch ein Anspruch auf Schadensersatz für den umgangsberechtigten Elternteil, wenn ihm finanzielle Schäden durch die Umgangsverweigerung entstanden sind (Benzinkosten, Fahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel).
Wird das Umgangsrecht trotz gerichtlicher Durchsetzung verweigert, drohen dem anderen Elternteil unter Umständen rechtliche Konsequenzen: Ordnungsgelder, Schadenersatzforderungen, Zwangshaft und Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts.
Wie bereits beschrieben, ist die Gestaltung des Umgangsrechts nicht immer unkompliziert. In einigen schwerwiegenden Fällen verweigert das hauptsächlich betreuende Elternteil dem umgangsberechtigten Elternteil sogar den Umgang mit dem Kind. Nicht immer ist dies rechtmäßig, sodass sich das betroffene Elternteil außergerichtlich oder gerichtlich wehren muss. Ein einvernehmliches Umgangskonzept kann nicht von den Eltern erarbeitet werden. Doch wer hilft bei der Durchsetzung und Ausübung des Umgangsrechts?
Zunächst sollten Sie sich an das Jugendamt wenden und sich kostenlos beraten lassen. Anschließend kümmert es sich um die Erarbeitung einer einvernehmlichen Lösung und versucht eine sinnvolle Umgangsregelung mit dem anderen Elternteil festzulegen. Auch Großeltern, Geschwister und Pflegeeltern können die Beratung wahrnehmen.
Sollte sich der entsprechende Elternteil immer noch weigern und keine zukunftsfähige Lösung möglich sein, muss ein Anwalt für Familienrecht engagiert werden, um das Umgangsrecht gerichtlich vor dem Familiengericht durchzusetzen. Das Gericht prüft anschließend, welche Regelung zum Umgang am besten dem Wohl des Kindes entspricht. Im Gerichtsurteil werden letztendlich die Umgangsregelungen festgelegt, die wiederum von beiden Elternteilen eingehalten werden müssen.
Ist eine einvernehmliche Lösung nicht möglich, muss das umgangsberechtigte Elternteil das Umgangsrecht einklagen. In diesem Fall regelt das Familiengericht den Umgang mit dem Kind und ordnet Umgangsregelungen an. Das Gericht beruht sich bei seinen Entscheidungen immer auf das Kindeswohlprinzip gemäß BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). Demnach werden Regelungen getroffen, die am besten dem Wohl des Kindes entsprechen.
Ein Anwalt für Familienrecht ist insbesondere dann empfehlenswert, wenn ein Elternteil vehement den Umgang mit dem Kind verweigert. Sollte keine Einigung mithilfe des Jugendamts oder der Kindesschutzbehörde möglich sein und das Elternteil sich nach wie vor weigern, den Kontakt zum anderen Elternteil zuzulassen, muss das Umgangsrecht gerichtlich durchgesetzt werden.
In diesem Fall ist eine außergerichtliche Einigung immer noch möglich, wenn der Anwalt eine Einigung mit dem anderen Ehepartner erzielen kann. Ist dies nicht möglich, muss letzten Endes der gerichtliche Weg gegangen werden. Ein Anwalt für Familienrecht berät Sie ausführlich bei allen weiteren Schritten und unterstützt Sie, ihr Recht vor dem Familiengericht durchzusetzen.
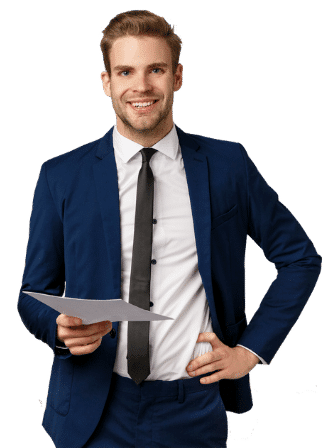
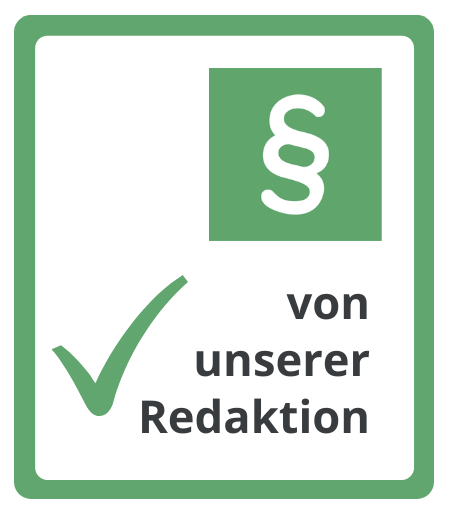
Unsere juristische Redaktion erarbeitet jeden Artikel nach strengen Qualitätsrichtlinien hinsichtlich Inhalt, Verständlichkeit und Aufbereitung der Informationen. Auf diese Art und Weise ist es uns möglich, Ihnen umfassende Informationen zu unterschiedlichsten Rechtsthemen zu bieten, die jedoch lediglich eine erste Information darstellen und keine anwaltliche Beratung ersetzen können.
Wenn Sie dieses YouTube/Vimeo Video ansehen möchten, wird Ihre IP-Adresse an Vimeo gesendet. Es ist möglich, dass Vimeo Ihren Zugriff für Analysezwecke speichert.
Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung
[finditoo-listing-email-link]