Die Zugewinngemeinschaft ist der gesetzliche Güterstand in Deutschland und trotzdem wissen viele Menschen viel zu wenig darüber. Das Güterrecht hat Auswirkungen auf unterschiedliche Bereiche und ist vor allem für die Vermögensverhältnisse während und nach einer Ehe von höchster Relevanz. Dementsprechend gut überlegt sollte die Wahl des Güterstandes sein. In diesem Beitrag erfahren Sie alles, was Sie über die Zugewinngemeinschaft wissen müssen, welche Auswirkungen sie auf die Ehe hat und was der Zugewinnausgleich ist. Zum besseren Verständnis finden Sie immer wieder Beispiele und exemplarische Rechnungen.
In Deutschland leben statistisch gesehen die meisten Menschen im Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Gehen Sie aber auf die Straße und fragen die Menschen, was das überhaupt konkret für ihr Vermögen bzw. für Ihre Ehe bedeutet, so schaut man häufig in fragende Gesichter.
Ein Güterstand regelt allgemein die Vermögensverhältnisse innerhalb einer wirksam geschlossenen Ehe. Eines der wichtigsten Merkmale der Zugewinngemeinschaft ist, dass es während der gesamten Ehe kein Gesamteigentum gibt. Das bedeutet: das Vermögen der Eheleute ist zu jedem Zeitpunkt getrennt (anders ist das bei der Gütergemeinschaft).
Auch wenn das Vermögen während der Ehe wächst, steht der Zuwachs im ersten Moment allein demjenigen Ehegatten zu, der den Zugewinn erwirtschaftet hat. Erst dann, wenn die Zugewinngemeinschaft endet (Scheidung oder Tod), erfolgt die sogenannte güterrechtliche Auseinandersetzung. Im Zuge dieser wird der so genannte Zugewinnausgleich berechnet und abgewickelt.
Viele Menschen glauben noch heute, dass es zwingend notwendig ist, einen Ehevertrag abzuschließen, wenn man selbst oder der Partner Schulden hat. Tatsächlich ist die Gütergemeinschaft aber der einzige Güterstand, in welchem der Ehepartner für die Schulden des anderen mithaftet. Ein Vorteil der Zugewinngemeinschaft ist, dass keine Schulden vom Ehegatten übernommen werden müssen. Selbst wenn ein Partner in die Ehe kommt und gar kein Vermögen, sondern Schulden mitbringt, haftet dieser in der Ehe alleine für seine Verbindlichkeiten.
Rechtlich ist der Grund dafür in der Vermögenstrennung die in §1363 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) geregelt wird, zu suchen. Dadurch, dass Mann und Frau kein “echtes” gemeinsames Vermögen haben, kann auch immer nur einer persönlich haften.
Sie haben bereits gelernt, dass die Vermögen der Eheleute getrennt sind und selbstständig verwaltet werden. Trotzdem kann vor allem über gemeinsame Gegenstände und erhebliche Vermögenswerte nicht willkürlich verfügt werden. Es gibt sogenannte Verfügungsbeschränkungen. Diese sollen das Vermögen der Eheleute schützen.
Tatsächlich darf ein Ehepartner nicht alleine über sein gesamtes Vermögen verfügen. Es bedarf einer Einwilligung. Möchte zum Beispiel der Ehemann sein gesamtes Geld an seinen Sohn verschenken, so muss zuerst die Frau zustimmen. Die Betonung liegt hier auf “gesamtes” Vermögen. Sofern nur über einen Teil des Vermögens verfügt wird, kann es sein, dass keine Zustimmung erforderlich ist. In der Rechtsprechung hat sich ein Grenzwert von 10-15 % Restvermögen nach Verfügung etabliert:
Wenn Sie über einen großen Teil Ihres Vermögens alleine verfügen möchten, müssen Sie also darauf achten, dass Ihnen mind. 10-15 % Ihres Gesamtvermögens erhalten bleiben.
Wenn Sie Aktien im Wert von 300.000 Euro verschenken möchten und ein Barvermögen von 50.000 Euro aufweisen, so können Sie dies ohne Zustimmung tun. Nachdem Sie die Aktien abgegeben haben, bleiben Ihnen nämlich noch 50.000 Euro. Das sind rund 16 % von ursprünglich 350.000 Euro Gesamtvermögen (16 % > mind. 15 % Restvermögen).
Haben Sie hingegen nur das Aktienpaket und kein anderes Vermögen, so muss Ihr Partner zustimmen. §1369 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sagt weiterhin, dass Sie über Gegenstände des ehelichen Haushalts nur dann verfügen dürfen, wenn der andere Ehepartner einwilligt. Zu den Haushaltsgegenständen zählen vor allem:
Ganz konkret bedeutet das, dass solche Gegenstände des ehelichen Haushalts nur mit Zustimmung beider Eheleute verkauft werden dürfen. Andernfalls ist der Kaufvertrag unwirksam.
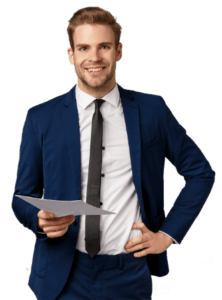
In einigen Fallkonstellationen übernimmt das Grundbuchamt eine Kontrollfunktion. Das bedeutet: Sie dürfen – wie bereits erfahren – nicht einfach Ihr Haus verkaufen, sofern dieses einen erheblichen Teil Ihres Vermögens ausmacht.
Sollte das Grundbuchamt Grund zur Annahme haben, dass das Haus, welches verkauft werden soll, doch einen erheblichen Teil des Vermögens des Eigentümers ausmacht, kann es sich vorbehalten, die Zustimmung des Ehepartners einzuholen, bevor der Verkauf abgewickelt wird. Außerdem kommt es in der Praxis häufig vor, dass eine Immobilie übertragen, das Wohnrecht aber bestehen bleiben soll.
Sie sind mittlerweile 60 Jahre alt und möchten Ihr Haus vorzeitig Ihrem Sohn vermachen. Ihr Barvermögen umfasst 300.000 Euro, während das Haus 150.000 (300 Euro Miete / Monat) Euro wert ist. Fraglich ist, ob Sie das Haus einfach verschenken und sich im Gegenzug ein Wohnrecht / Nießbrauchsrecht einräumen lassen dürfen?
Tatsächlich ist auch hier entscheidend, dass Ihnen nach der Verfügung noch mehr als 15 % Vermögen bleiben. Nur dann ist die Übertragung zustimmungsfrei. In strittigen Fällen hat es sich in der Rechtspraxis etabliert, das Wohnrecht auf den Immobilienwert anzurechnen. Das mindert den Wert, sodass das Vermögen, welches übrig bleiben muss, damit der Ehepartner kein Veto einlegen darf, geringer ist:
300.000 Euro (Restvermögen) sind deutlich mehr als 10 % von 360.000 Euro (Gesamtvermögen = Immobilienwert + Barvermögen). Mithin kann das Grundstück / Haus ohne Zustimmung des Ehepartners übertragen werden!
Eine Immobilie kann mit einer Grundschuld / Hypothek belastet werden. Dies geschieht in den meisten Fällen zur Kreditsicherung. In der Praxis ist es so, dass ein Ehepartner eine Grundschuld aufnehmen darf, wenn:
In allen anderen Fällen muss der Ehepartner zustimmen, bevor die Grundschuld in Kraft tritt.
Die Zugewinngemeinschaft ist der ordentliche Güterstand in Deutschland. Das bedeutet für Sie, dass Sie immer dann in einer Zugewinngemeinschaft leben, wenn Sie keinen anderen Güterstand bestimmen. Zeitpunkt der güterrechtlichen Wirkung ist der Beginn der Ehe – namentlich die Eheschließung. Wie bei allen anderen Güterständen gibt es auch hier zwei Möglichkeiten die Zugewinngemeinschaft aufzulösen:
Endet die Zugewinngemeinschaft, so kommt es zur güterrechtlichen Auseinandersetzung. Das klingt sehr kompliziert, ist aber eigentlich leicht zu verstehen. In der Praxis besteht die Schwierigkeit regelmäßig darin, die benötigten Daten zuverlässig und beweisbar zu erheben. Hierfür bietet es sich an, noch während der Ehe regelmäßig nachweisbar zu belegen, welches Vermögen tatsächlich während der Ehe hinzugekommen ist und welche Vermögenswerte bereits vor der Eheschließung bestanden. Wie es der Name schon sagt, ist letztlich hierbei der “Zugewinn” entscheidend. Dieser kann mit der folgenden, einfachen Formel berechnet werden:
Sie müssen also einen quantitativen Vergleich anstellen – eine Plus-Minus Rechnung. Was war vor der Ehe an Vermögenswerten schon vorhanden und was ist während der Ehe hinzugekommen? Besonders dann, wenn Paare jung heiraten, ist das Anfangsvermögen häufig gering. Mit Anfang 20 haben sich die Eheleute selten schon erhebliche Vermögenswerte ansparen können. Übrigens zählen Erbschaften und Schenkungen häufig zum Anfangsvermögen und sind dementsprechend nicht im Zuge des Zugewinnausgleichs an den Partner auszuzahlen.
Vor allem dann, wenn Sie bereits ein erhebliches Vermögen haben, sollten Sie in jedem Fall ein Vermögensverzeichnis erstellen. Dieses ist ein rechtsverbindlicher Nachweis über Ihr Anfangsvermögen. Das bringt für beide Eheleute Sicherheit und im Falle einer Scheidung besteht vermindertes Konfliktpotential, da es sich um einen rechtsverbindliches Dokument handelt.
Der Zugewinnausgleich lässt sich theoretisch in vier einfachen Schritten berechnen:
Das klang alles noch sehr theoretisch? Dann sollten Sie sich unsere Beispielrechnung für einen typischen Zugewinnausgleich ansehen:
Schritt 1:
| Ehefrau | Ehemann |
|
|---|---|---|
| Anfangsvermögen | 40.000 Euro | 100.000 Euro |
| Endvermögen | 60.000 Euro | 200.000 Euro |
| Rechnung: | 60.000 – 40.000 = | 200.000 – 100.000 = |
| Zugewinn | 20.000 Euro Zugewinn | 100.000 Euro Zugewinn |
So könnte eine typische Ausgangslage bei einer Scheidung aussehen: die Frau hat einen vergleichsweise niedrigen Zugewinn über die Jahre, da sie sich um den Haushalt und die Kinder gekümmert hat. Der Ehemann hingegen war geschäftlich aktiv und konnte sein Vermögen verdoppeln. Fraglich ist, in welchem Umfang der Zugewinnausgleich nun stattfinden muss.
Schritt 2:
Wer hat den höheren Zugewinn erzielen können? In diesem Beispiel ist es eindeutig: der Ehemann hat ein Vermögenswachstum von 100 %, während die Frau nur ein Drittel mehr hat. Dementsprechend muss der Zugewinn durch den Mann ausgeglichen werden.
Schritt 3:
Nun stellt sich die Frage, wie viel denn Frau und Mann hätten, wenn der Zugewinn “fair” zwischen beiden Parteien aufgeteilt wäre:
Schritt 4:
Im letzten Schritt müssen Sie den Zugewinn, der beiden Partner zusteht, mit dem tatsächlichen Zugewinn abgleichen. Die Differenz muss vom Partner mit dem höheren Zugewinn an den anderen Partner ausgezahlt werden.
Ergebnis:
In dieser Fallkonstellation müsste der Ehemann einen Zugewinnausgleich in Höhe von 40.000 Euro an die Ehefrau auszahlen.
Mischformen unterschiedlicher Güterstände sind in Deutschland nicht zulässig. Sie können also nicht die Gütertrennung vereinbaren, trotzdem aber auf den Zugewinnausgleich bestehen. Was jedoch möglich ist, ist die Zugewinngemeinschaft zu modifizieren. Dafür müssen Sie einen Ehevertrag abschließen. Im Ehevertrag können die gesetzlichen Bestimmungen zur Zugewinngemeinschaft individuell angepasst werden. In vielen Situationen macht das durchaus Sinn. Vereinbaren Sie am besten einen Termin bei einem Fachanwalt für Familienrecht. Gemeinsam entwickeln Sie einen Ehevertrag, der perfekt auf Ihre Lebens- und Vermögenssituation passt.
Sollten Sie die Zugewinngemeinschaft modifizieren wollen, ist der Besuch beim Anwalt für Familienrecht nicht zu vermeiden. Auch wenn Sie grundsätzlich den Ehevertrag frei gestalten können, dürfen Sie keine Regelungen treffen, die einen Ehepartner in nicht zumutbarer Weise benachteiligen. Der Ehevertrag wird außerdem erst dann wirksam, sobald er von einem Notar beurkundet wurde. Alternativ kann er auch durch ein Gericht protokolliert werden – das ist aber eher die Ausnahme.
Erbschaften sollen laut dem deutschen Gesetzgeber nicht zum Endvermögen zählen. Verständlicher ausgedrückt bedeutet das, dass eine während der Ehe erworbene Erbschaft nicht im Zuge des Zugewinnausgleichs geteilt werden muss. Diese Regelung findet seine dogmatische Begründung darin, dass ein Erbe meist dem einen Ehepartner persönlich zukommen soll. Ein Ausnahmefall ergibt sich dann, wenn ein Erbe während der Ehe einen Wertzuwachs erfährt. Denkbar sind:
Der Güterstand bzw. die Zugewinngemeinschaft hat außerdem einen entscheidenden Einfluss auf das Erbe. Es macht in manchen Konstellationen durchaus einen erheblichen Unterschied, ob die Zugewinngemeinschaft durch Scheidung oder durch Tod aufgehoben wird. Für den Fall, dass kein Testament hinterlassen wurde, tritt die gesetzliche Erbfolge in Kraft. Das bedeutet, dass dem hinterbliebenen Ehepartner ein Viertel aus der Erbschaft zusteht und noch ein Viertel als pauschaler Zugewinnausgleich. Insgesamt bekommt er / sie also die Hälfte des Vermögens. Der Unterschied wird an zwei Beispielen ganz deutlich:
Hochzeit ohne erhebliches Anfangsvermögen
Heiratet ein Paar in jungen Jahren und hat kein erhebliches Anfangsvermögen, so macht es keinen so bedeutenden Unterschied, ob die Zugewinngemeinschaft auf Grund von einer Scheidung oder Tod aufgelöst wird:
| Ehefrau | Ehemann |
|
|---|---|---|
| Anfangsvermögen | 10.000 Euro | 0 Euro |
| Endvermögen | 20.000 Euro | 200.000 Euro |
| Zugewinn | 10.000 Euro | 200.000 Euro |
| Zugewinnausgleich bei Scheidung | bekommt 95.000 Euro | muss 95.000 Euro zahlen |
| Im Todesfall | bekommt 100.000 Euro | bekommt 10.000 Euro |
Wie Sie sehen macht es hier “nur” einen Unterschied von 5.000 Euro für die Frau (die Person, die weniger Zugewinn hat). Sollten die Anfangsvermögen höher sein – zum Beispiel, wenn Sie sich mit 50 Jahren entscheiden nochmal zu heiraten – sieht das schon ganz anders aus…
| Ehefrau | Ehemann |
|
|---|---|---|
| Anfangsvermögen | 300.000 Euro | 100.000 Euro |
| Endvermögen | 350.000 Euro | 150.000 Euro |
| Zugewinn | 50.000 Euro | 50.000 Euro |
| Zugewinnausgleich bei Scheidung | kein Zugewinnausgleich | kein Zugewinnausgleich |
| Im Todesfall | bekommt 75.000 Euro | bekommt 175.000 Euro |
Hier macht es durchaus finanziell einen Unterschied, ob die Ehe durch Tod oder Scheidung endet. Dementsprechend sollten Sie diese Aspekte bei der Planung Ihrer Erbschaft berücksichtigen.
Bei den Schenkungen, die während der Ehe erfolgen, sieht es ähnlich aus: Schenkungen und Zuwendungen, die einen Ehepartner persönlich bereichern sollen, werden nicht zum Endvermögen hinzugezählt. Sie werden in der Regel als Teil des Anfangsvermögens vermerkt. Aber auch hier gibt es einen Ausnahmefall: in manchen Fällen handelt es sich um eine Schenkung, die explizit an beide Eheleute gerichtet ist. Populäre Beispiele sind Hochzeitsgeschenke (Geld für gemeinsame Anschaffungen etc.).
Das deutsche Recht kennt grundsätzlich drei Güterstände, die Zugewinngemeinschaft, die Gütertrennung und die Gütergemeinschaft. Für welchen Güterstand Sie sich entscheiden sollten, hängt ganz von Ihrer individuellen Lebens- und Vermögenssituation ab. Die güterrechtliche Entscheidung kann erhebliche Auswirkungen auf Ihre Zukunft (Scheidung, Zugewinnausgleich, Erbe) haben und deshalb sollten Sie sichergehen, dass Sie den richtigen Güterstand wählen.
Die Wahl des richtigen Güterstandes ist im besten Fall wortwörtlich eine Entscheidung fürs Leben. Dementsprechend sollten Sie sich gut überlegen, wie Sie Ihre Zukunft – vor allem finanziell – gestalten möchten. In vielen Fällen ist eine Zugewinngemeinschaft der Güterstand der Wahl.
Sind Sie sich unsicher, welcher Güterstand für Sie optimal ist? Oder möchten Sie eine modifizierte Zugewinngemeinschaft mittels Ehevertrag? Dann sollten Sie unbedingt einen Anwalt für Familienrecht aufsuchen. Dieser hilft Ihnen Ihre Situation zu analysieren und einen sinnvollen Plan für die Zukunft zu erstellen. Ebenso ist es ratsam einen Anwalt aufzusuchen, sollten Sie sich in einer güterrechtlichen Auseinandersetzung befinden (Scheidung / Trennung). In dieser schwierigen Zeit unterstützt Sie Ihr Anwalt rechtlich mit Rat und Tat, damit es zu einem (vermögensrechtlich und moralisch) fairen Ergebnis kommt.
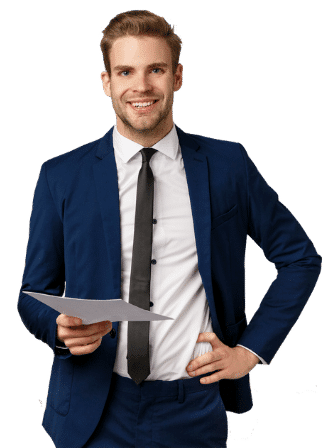
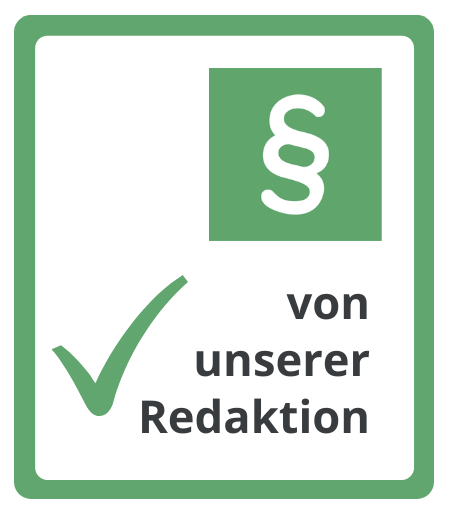
Unsere juristische Redaktion erarbeitet jeden Artikel nach strengen Qualitätsrichtlinien hinsichtlich Inhalt, Verständlichkeit und Aufbereitung der Informationen. Auf diese Art und Weise ist es uns möglich, Ihnen umfassende Informationen zu unterschiedlichsten Rechtsthemen zu bieten, die jedoch lediglich eine erste Information darstellen und keine anwaltliche Beratung ersetzen können.
Wenn Sie dieses YouTube/Vimeo Video ansehen möchten, wird Ihre IP-Adresse an Vimeo gesendet. Es ist möglich, dass Vimeo Ihren Zugriff für Analysezwecke speichert.
Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung
[finditoo-listing-email-link]